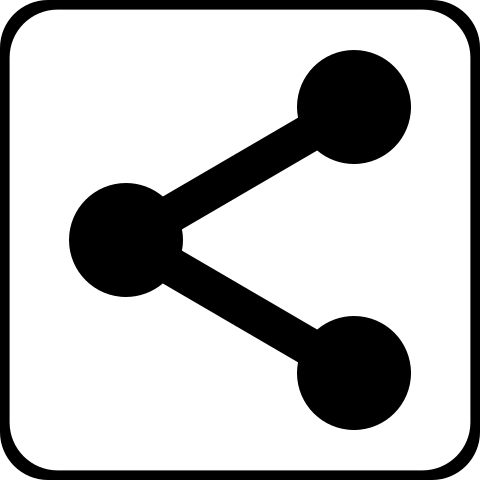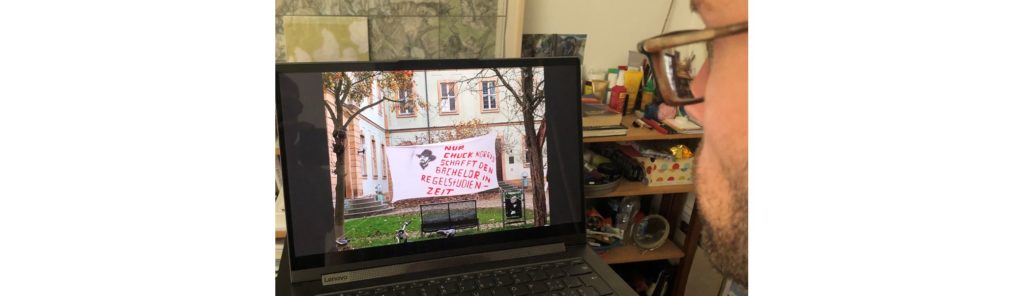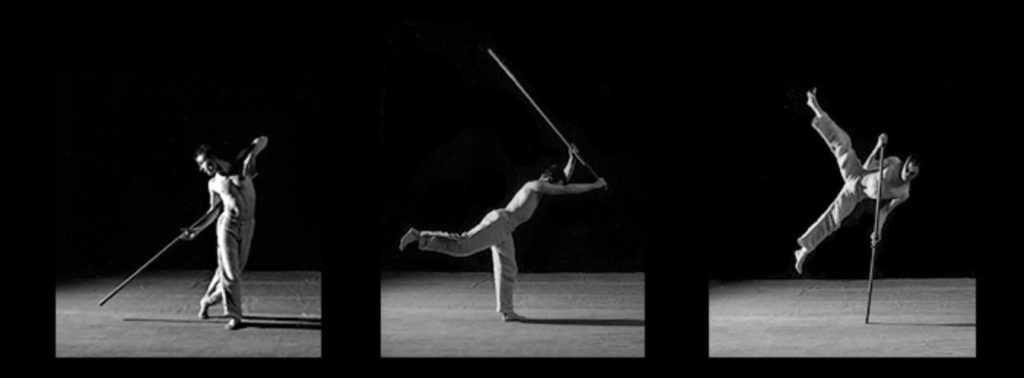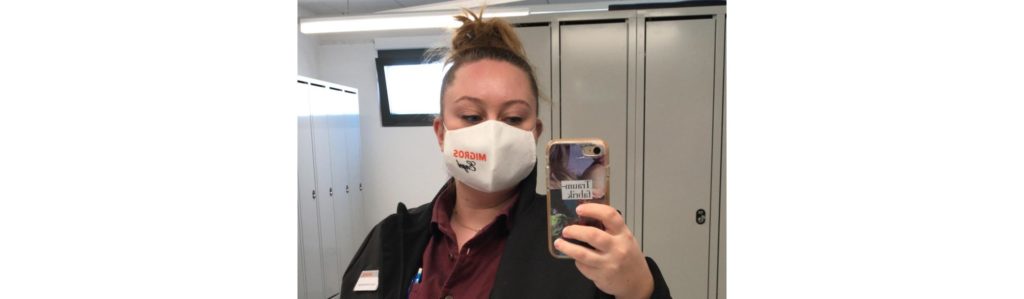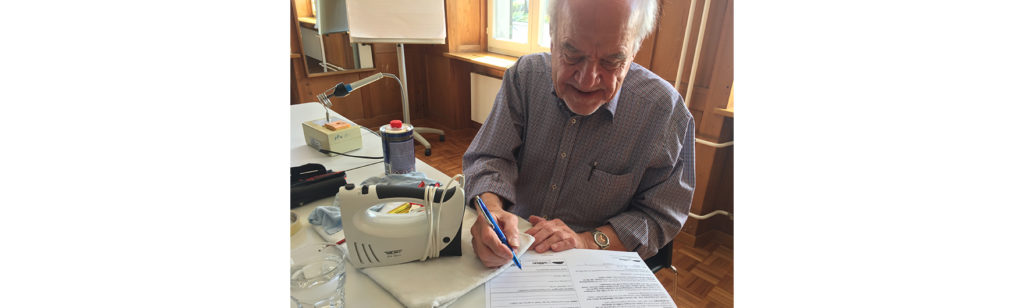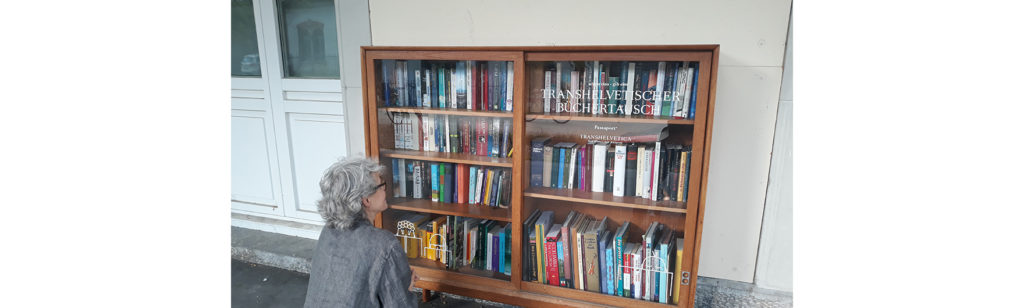Die Firma, in der ich arbeite, baut Orgeln. Wir machen fast alles selber, es ist noch immer richtig währschaftes Handwerk. Noch bis vor wenigen Jahren hatten wir einen eigenen Eichenwald, denn beim Orgelbau ist das meiste aus Holz. Ausser die Orgelpfeifen sind aus Metall. Die Pfeifenmacher heizen das Metall in einem grossen, alten Kessel auf, giessen es auf einen langen Tisch, hobeln, schneiden, klopfen und wickeln es am Schluss zu einer Röhre. Das ist strenge Arbeit. Dafür können wir die Klangfarben nach Wunsch der Kunden bestimmen. Das geht bei Pfeifen ab Stange nicht.
Das Innere einer Orgel ist sensationell komplex, viel komplexer als beispielsweise ein Klavier. Von der Taste gibt es sehr lange Wege zur Pfeife. Wippen, Drähte, Winkel, Wellen, Windkanäle, Registerstangen und so weiter, abertausende verhängte Teilchen. Das braucht eine ganz aufwendige Planung. Ich habe mit den kleinen Teilchen zu tun, zum Beispiel tuche ich Löcher von Holzwinkeln oder Wippen mit Kaschmir aus, damit die Drähte darin nicht klappern. Oder ich stanze Leder und Filz, klebe, schneide, bohre, schraube, grafitiere und vieles mehr.
Meinen ursprünglichen Beruf als Hauspflegerin habe ich irgendwann mal aufgegeben. Ich hatte dann riesiges Glück, dass mein Laufbahnberater nicht nur Psychologe, sondern auch Schreiner war und im Orgelbau gearbeitet hatte. Nachdem mich verschiedene Berufsideen nicht überzeugt hatten, sagte er irgendwann: «dann gehen Sie halt in den Orgelbau, die brauchen Frauen für feine Sachen». Das habe ich dann getan.
Orgelbauen ist wie gesagt wahnsinnig kompliziert. Auch nach zehn Jahren Arbeit habe ich null Ahnung, wie eine Orgel funktioniert. Ich kenne zwar ganz viele Einzelteile, aber wie am Schluss alles zusammenspielt, das ist etwas anderes. Und genau muss es sein, ganz genau arbeiten muss man, es muss laufen wie ein Örgeli! Das Schöne daran ist: wir sind wie eine Familie, wir arbeiten zusammen an einem Projekt, eine Orgel aufs Mal. Das dauert je nach Orgelgrösse mehrere Monate bis zu einem Jahr.

Die Klimaseniorinnen bringen mich immer wieder zum Staunen. Dass aus der Idee von wenigen Menschen so etwas entstehen kann, eine grosse Bewegung, bei der viele Menschen mit Herzblut mitmachen, ist für mich unglaublich schön.
Den Ausschlag gab 2015 ein Gerichtsurteil in Holland, das die Regierung dazu verpflichtete, mehr für Klimaschutz zu tun, um die Grundrechte der eigenen Bürgerïnnen zu schützen. Dass die Klage von rund 900 Zivilistïnnen Erfolg hatte, war eine weltweite Sensation. In der Schweiz kann in einem solchen Fall nur klagen, wer eine besondere Betroffenheit nachweisen kann. Die zunehmenden Hitzewellen setzen älteren Menschen stark zu. Unsere Analysen zeigten, dass ältere Frauen noch stärker betroffen sind als Männer. So kamen wir auf die Idee, die KlimaSeniorinnen aufzubauen.
Ich hatte Glück, dass ich für Greenpeace arbeite und genügend Wissen und Ressourcen bekam, um mit einem hoch motivierten Anwaltsbüro den Aufbau der Schweizer Klimaklage aufzugleisen. Als die rechtliche Analyse vorlag, ging es dann schnell. Schon bald sassen wir in einem Gemeinschaftsraum mit zehn Seniorinnen. Dieser Moment war ganz speziell. Alle waren Feuer und Flamme. Ernst und bestimmt haben sie gesagt, wir verklagen die Schweiz. Die Kassiererin vom neugegründeten Verein bedankte sich und sagte: ich habe nie gedacht, dass ich nochmals so aktiv werde. Aber hier kann endlich wirklich etwas passieren, deshalb engagiere ich mich. Jemand hat sie mal gefragt: seid ihr nicht von den Umweltschützern instrumentalisiert? Sie haben gesagt: nein, im Gegenteil, wir haben uns die unter den Nagel gerissen!
Heute sind es fast 2000 Seniorinnen, die den Fall mittragen. Wir sind auch Teil einer weltweiten Bewegung, zusammen mit Leuten aus Südafrika, Norwegen oder den Philippinen. Weltweit laufen mehr als 1200 Klagen. Wenn Regierungen oder die Wirtschaft unsere Grundrechte nicht schützen, muss man auf die Justiz zurückgreifen. In allen möglichen Medien wurde über uns berichtet. Wir vermitteln, dass Klimaschutz mit Menschenrechten zu tun hat, dass es auch darum geht, die Gesundheit der Menschen im Hier und Jetzt zu schützen.
Es ist für mich sehr schön, Teil von etwas Grossem zu sein, vom einem Schweizer Projekt mit globaler Dimension. Vielleicht ist dieses Teilsein von etwas Grossem sogar eine Grundbedingung des Glücks für mich. Es geht darum, für andere da zu sein, was nur funktioniert, wenn es um mehr als nur um mich selbst geht. Das kann die Familie sein, die Gemeinschaft, andere Lebewesen, die Welt oder ein Baum. Ich erlebe das in meiner Arbeit als Umweltschützer und auch in meiner Arbeit auf unserem Hof. Hier arbeite ich ganz konkret, mit den Händen, mit Pflanzen, Tieren und Menschen. Dabei habe ich nicht das Gefühl, ich müsse Arbeit von Freizeit trennen, es geht einfach darum erfüllt zu leben. Dass ich in all meinen Tätigkeiten derselbe Mensch sein kann, ist mir wichtig für die Lebensqualität.
Den KlimaSeniorinnen steht nun die grösste und letzte Etappe bevor. Am Bundesgericht wurde unsere Klage abgewiesen. Jetzt kommt die Klage vor den europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und ist da eine der ersten Klimaklagen überhaupt. Der Frust des Nicht-Gehört-Werdens von den Schweizer Gerichten hat sich in einen potentiellen Präzendenzfall entwickelt, der weit über die Schweiz hinaus wirken kann. Aus dem «Oh shit, wir hatten kein Glück» ist jetzt ein potentieller Once-in-a-Lifetime-Fall geworden.

Ich war eine Weile in Portugal und habe bei einer Frau in einer ländlichen Gegend ein Zimmer gemietet. Dort konnte ich einige spannende Dinge beobachten.
Zum Beispiel kamen alle paar Tage benachbarte Bauern vorbei und brachten Tomaten oder Kisten voller Süsskartoffeln mit. Sie dachten wahrscheinlich, dass die Frau froh ist um ein bisschen Unterstützung, und gleichzeitig stellten sie sicher, dass bei ihr alles in Ordnung ist, weil sie ja alleine wohnt.
Auch sonst, wenn die Bauern hier mehr ernten, als sie brauchen oder verkaufen können, legen sie die überschüssigen Produkte neben das Feld. Die Leute dürfen sich einfach bedienen, Kartoffeln, Gemüse, Melonen, Kürbisse… Und wenn ein Feld abgeerntet ist, dürfen alle das hängengebliebene Obst oder liegengebliebene Gemüse ernten, so wie ich es verstanden habe, gibt es dafür sogar ein Gesetz.
Von einer lustigen Situation erzählte mir ein Freund: er brachte dem Nachbarn Peperoni aus seinem Garten vorbei, aber die hatten davon ebenfalls kistenweise. Sie haben sich dann geeinigt, dass sie sich gegenseitig welche schenken.
Und noch eine schöne Entdeckung: man darf hier auf öffentlichen Grünflächen anpflanzen. Ein besonders schönes Beispiel fand ich auf einer Wiese gleich neben einer Strasse. Einwohner vom Städtchen nebenan haben ein Gemüsebeet angelegt, Bananen- und andere Bäume gepflanzt und einige Tische und Stühle hingestellt. Wenn man an einem warmen Abend vorbeifährt, sieht man dort viele Leute sitzen.
Mit Bananen funktioniert das so: sie werden grün in die Schweiz geliefert und reifen dann eine Woche weiter, bevor sie in den Laden kommen. Nicht alle Bananen entsprechen den Standards, zum Beispiel sind sie nicht im praktischen Fünferbund oder sie haben Kühlschäden. Dann werden sie noch grün weggeworfen, tonnenweise. Ich arbeite in einer Kommunikationsagentur, aber wir wollten schon lange zusammen auch ganzheitliche Projekte machen, im Grossen denken können. Bananen kommen von so weit weg, dass allen sofort klar ist, was es für ein unglaublicher Ressourcenverschleiss ist, so viele wegzuwerfen. Wir fanden das deswegen den perfekten Fall, fragten uns: schaffen wir, hier eine Lösung zu entwickeln, das Problem sichtbar zu machen und dabei eine gute Geschichte zu erzählen?
Unsere erste Idee war, Bananen haltbar zu machen. Zwei Wochen haben wir bei mir zuhause gedörrt, gebacken, ausprobiert. Aber wir selbst waren ja keine Experten, wir brauchten Profis, die mitdenken und mitentwickeln, die schauen, dass es lebensmitteltechnisch verhebt. Im Thurgau gibt es einen Obstbetrieb, die trocknen regionale Früchte. Ich habe mir gesagt, überwind dich und ruf an, weil, ich telefonier eigentlich nicht gerne. Wir haben dann eine halbe Stunde telefoniert und sie haben gesagt, komm doch vorbei.
Ich habe unsere Muster mitgenommen und nach 40 Minuten sagten sie, ja, probieren wir das mal… Sie sind einfach Macher. Du läufst rein und es wird gemacht. Im Januar haben wir telefoniert, im Februar war ich dort, dann haben sie mir Prototypen geschickt, wir haben drei Testläufe gemacht, Ende April waren wir mit getrockneten Bananen mit oder ohne Schokolade auf dem Markt und nach fünf Tagen schon ausverkauft.
Die grosse Frage war: sind Scheibchen oder Stängeli feiner? Dann hat sich gezeigt, dass man sich in der Produktion von Scheibchen leichter verletzen kann. Deshalb haben wir uns für Stängeli entschieden. Es hat unsere Partner schon überrascht, dass das unsere Entscheidung beeinflusst hat. Man kennt das halt nicht, es geht normalerweise immer nur um Preis, Produkt und Menge in der Lohnproduktion. Niemanden interessieren die Zwischenschritte. Mich hat es interessiert, weil’s mich interessiert. Ich möchte näher beim Lebensmittel sein. Wenn man versteht, dass es Handarbeit ist, was alles für Gedanken reinfliessen, dann wertschätzt man es auch. Sie haben mich gefragt: willst du wirklich schauen kommen, rüsten kommen? Ja klar! Und dann nach einer halben Stunde merke ich, die scheiss Bananen sind alle anders krumm und alle haben gelacht.
Am Anfang war ausgeschlossen, dass unsere Partner die Bananen auch vertreiben. Wenn man 25 Jahre nur regionale Früchte verkauft, dann kann man ja nicht plötzlich mit Bananen kommen. Und dann an einem Freitagnachmittag um fünf Uhr am Telefon sagten sie: wir nehmen sie zu uns ins Sortiment. Ein unglaublicher Vertrauensbeweis, ich konnte es kaum glauben.
Das Bananentrocknen ist auch ressourcentechnisch sinnvoll, denn im Frühsommer gibt es keine Äpfel zum Trocknen und die Trockenmaschinen stehen still. Während dieser Zeit trocknen wir jetzt Bananen und können die Maschinen auslasten. Nach diesem Prinzip hatten wir eine zweite Idee: Bananen einzufrieren, denn vor allem im Winter gibt es wenig Gemüse, die Gemüsegefrieranlagen stehen still. Wir haben bereits einen Gefrierbetrieb gefunden und eine Bäckerei, die daraus haltbares Bananenbrot im Weckglas macht. Und die neuste Idee ist jetzt, im Sommer aus Tomaten und Bananen Ketchup oder Tomatensauce herzustellen, dann, wenn es immer auch einen Überschuss an Tomaten gibt. Das machen wir zusammen mit dem Küchenchef eines Sozialunternehmens.
Wir haben die Prozesse in der Welt so gross und starr designt, dass es oft gar nicht möglich ist, flexible Lösungen zu finden. Aber eigentlich müssten einfach A und B und C zusammen reden, eine Lösung suchen dürfen. Eines Tages hat mich der Gefrierbetrieb angerufen. «Ich hätte Kapazität. Kannst du mir innert einer Woche eine Tonne Bananen besorgen?» Zum Glück haben wir eine super Beziehung mit einer Reiferei und sie stellten uns die Bananen beiseite. Optimalerweise kommen wir dahin, dass wir in der Schweiz eine grosse Datenbank haben, Rüebli, Mangos, Bananen, welchen Überschuss gibt es, was kann man wo abholen? Was wir mit Bananen machen, kann man mit jedem Produkt machen.
Die Frontscheibe meines Handys war in Trümmern, aber es funktionierte noch. Meine Kollegen rieten mir, ein neues Handy zu kaufen, weil es mit seinen über vier Jahren ja schon uralt sei. Ich wollte dem Rat folgen und schaute mir das Fairphone an. Man riet mir ab: Ich hätte ja nicht gerade eine Liebesbeziehung zu Handys, dann sei es schlauer, wieder ein iPhone anzuschaffen. Mein altes Telefon hatte ich von meinem ehemaligen Arbeitgeber bekommen, ich selber hätte es nicht gekauft, die schlimmen Arbeits- und Umweltbedingungen in der Fabrik hätte ich nicht unterstützen wollen. Ich zögerte solange mit dem Ersatz, bis ein junger Freund meinte, er helfe mir das alte Teil zu flicken. Bei der Gelegenheit könne man auch gerade den Akku ersetzen, dann sei die Sache so gut wie neu.
Er bestellte die Ersatzteile und ich rieb unterdessen weiter auf der kaputten Glasplatte herum, was mir mehr als einen Splitter im Finger einbrachte. Dann kam der Flickabend. Im Lieferumfang des Flick-Pakets war auch ein Werkzeugset mit «mikrochirurgischen» Tools. Im Netz gibt es für Akkuwechseln und Frontscheibenersatz Schritt-für-Schritt-Anweisungen. Die ersten circa zehn Schritte, Öffnen des Geräts, Auseinandernehmen der oberflächlichen Komponenten und so weiter, hatten wir ziemlich schnell erledigt und das gab uns Selbstvertrauen. Manche Arbeitsschritte brauchten vier Hände, zwei Pinzetten, einen Schräubchenzieher und sogar den Föhn. Wir wechselten erfolgreich den Akku. Für den Ersatz der Frontscheibe gab es zwei Optionen, eine kurze und eine lange. Natürlich haben wir die kürzere gewählt. Etwa eine Stunde nach dem Start der Aktion war alles fertig.
Wir haben uns auf die Schulter geklopft, ein Bier getrunken und dann packte ich das Handy ein und ging. Aber halt! Noch bevor ich aus der Türe war, habe ich gemerkt, dass die Manteltasche brandheiss war. Der Patient wurde schnellstens erneut operiert. Drei Stunden dauerte der zweite Eingriff. Wir mussten die Anschlüsse für Kamera, Lichtmessung etcetera von der alten auf die neue Scheibe übertragen, ein Käbeli-Salat in genau definierter Schichtung. Ich hätte nie im Leben erwartet, dass ich so eine Feinarbeit packen kann, nicht einmal als “Operationsassistentin”. Auch für meinen Freund, der sich mit normaler Computer-Hardware auskennt, war es eine Premiere in so kleinem Massstab zu arbeiten. Wir waren sehr zufrieden mit uns. Das Handy funktioniert auch Monate nach dem Eingriff perfekt und ich behüte es besser als vor dem Unfall.
Die Umweltseite sagt: ihr von der Wirtschaft wollt ja nur Geld machen. Die Wirtschaft sagt: die Politik will uns einfach einschränken und administrativ belasten und ihr von den NGOs braucht Schuldige, damit ihr eure Mitglieder bei der Stange halten könnt.
Versuche, Vertreter der Wirtschaft, Politik und NGOs an runden Tischen zusammenzubringen, gibt es zwar schon lange. Aber am Anfang war das einfach sehr emotional. Da sind Leute aufgestanden und wollten rauslaufen, weil sie fanden, so geht es gar nicht. Sobald die Diskussion in Richtung Politik ging, zum Beispiel um CO2-Steuern, waren sofort alle an der Decke, und je zeitlich näher ein politisches Geschäft, desto schwieriger war es. Wir haben füreinander unverständliche Sprachen gesprochen.
Ich habe mich stark in der Vermittlerrolle wahrgenommen, zwischen den fundamentalen Seiten der verschiedenen Interessensgruppen. Der zentrale erste Schritt war, einen Raum zu schaffen, in dem wir zusammenarbeiten können, im physischen und auch im übertragenen Sinn. Wir stellten dafür gemeinsam Regeln auf. Die wohl wichtigste: In diesem Raum sprechen wir nicht über Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen. Wir suchen nach Lösungen im Rahmen der bestehenden Leitplanken und egal, was auf der gesetzlichen Ebene passiert. Denn nur schon darin liegt ein riesiges Potential. Da haben wir immer darauf gepocht, wenn jemand wieder weggedriftet ist. Zuerst waren wir nur wenige, aber mit der Zeit haben alle begonnen, die Regeln durchzusetzen. Das war für mich sehr schön. Das war nun drin in unseren Köpfen. So konnten wir das Vertrauen aufbauen, um überhaupt miteinander sprechen zu können. Wir haben auch akzeptiert, dass wir uns ausserhalb dieses Raums öffentlich weiterhin kritisieren werden, wenn wir nicht einer Meinung sind.
So haben wir es geschafft, dass alle, Staat, Wirtschaftsverbände, NGOs, anerkennen, dass es Handlungsbedarf gibt: ganz klar, wir müssen unsere Umweltbelastung reduzieren. Das war ein grosser Schritt nach vorne. Kunststoff zum Beispiel häuft sich in der Umwelt mehr an, als dass er abgebaut wird. Das ist ein Fakt. Wir haben also ein Problem, wie lösen wir es? Wo sind die grössten Hotspots, was könnten wir in der Schweiz machen? Dank dem neuen Vertrauen konnten wir plötzlich über solche Dinge sprechen. Und dann haben wir nicht über Plastiksäckli oder Röhrli diskutiert, sondern über die grossen Dinge, Gebäudehüllen, Wasserrohre, Pneuabrieb. Jetzt machen die Umweltverbände mit der Kunststoffindustrie ein gemeinsames Projekt, das wäre vorher nicht machbar gewesen. Auch mit der Textilindustrie haben wir eine gemeinsame Initiative. Da konnte ich einfach das Telefon in die Hand nehmen und fragen: wäre das nicht etwas für euch?
Als ich noch für den WWF Unternehmenspartnerschaften aufgebaut habe, haben wir schnell gemerkt, dass wir keinen Schritt weiterkommen, wenn wir uns nur gegenseitig beschuldigen. Wo sind eigentlich die gemeinsamen Interessen? Wenn wir mit dieser Frage begonnen haben, war plötzlich von beiden Seiten die Bereitschaft da, sich auf eine konstruktive Diskussion einzulassen. Von meinem Hintergrund her verstehe ich die Bedürfnisse, Sicht und Sprache der Unternehmen. Gleichzeitig habe ich als Chef der Umweltorganisation PUSCH den Umwelthut an. Dieses Verständnis und die Akzeptanz von beiden Seiten haben mir sehr geholfen.
Innerhalb unseres Raumes sprechen wir nicht über Politik. Lustigerweise hat das dazu geführt, dass wir jetzt dafür ausserhalb des Raums zusammen über Politik reden können. Das geht hoch bis zum Nationalrat oder Ständerat, ich kann jemanden anrufen und fragen: was ist eigentlich das Problem für euch, wieso seid ihr zum Beispiel bei den Pestiziden so dagegen? Meistens stimmt die Antwort dann nicht mit dem überein, das plakativ in den Medien steht. Es hilft sehr, wenn man die politischen Anliegen der Gegenseite nicht über Medienschlagzeilen kennenlernt, sondern eins zu eins in der Diskussion.
Vor allem am Anfang wurde ich auch schon gefragt: Felix, verkaufst du nicht deine Seele, wenn du mit der Gegenseite Kompromisse eingehst? Aber ich bin überzeugt: die wirklich grossen Dinge können nur angepackt werden, wenn wir zusammenarbeiten. Rauszufinden, wo sind die Gemeinsamkeiten und mit was können wir alle leben, das macht bereits unter Umweltleuten sehr viel Spass. Und mit der Gegenseite ist das mindestens so spannend.
Ich habe mich sehr gefreut über die erste Karte im Briefkasten. Es ist ja nicht so häufig, dass ausser Rechnungen und der Zeitung etwas kommt. Dann ist die zweite Postkarte gekommen und es sieht ja wirklich schön aus bei dir. So langsam habe ich mir vorstellen können, wie du dort unten so lebst. Es ist auch so warm und sonnig, und du in den kurzen Hosen!
Nach einer Weile hatte ich mich schon daran gewöhnt, dass mindestens jeden zweiten Tag eine Karte kommt und dazu deine Erklärung, was ich darauf sehe. Als dann keine Karte mehr kam, habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber dann kamen drei auf’s Mal, eine so schön wie die andere, und dann nochmals zwei, und dann eher wieder einzelne. Im Ganzen etwa zwanzig. Ich habe immer viel Freude daran gehabt. Auch meine Spitexfrauen und der eine Spitexmann haben sie immer gerne angeschaut. Was der Briefträger wohl gedacht hat, dass ich auf einmal ständig so viel schöne Post bekomme?
Das Bild mit dem Mosaik hat mich an eine Reise vor vielen Jahren erinnert, als wir mit dem Bus durch Apulien fuhren. Da war in einer Kirche der ganze Boden ein einziges, riesiges Mosaik, es gab einen Baum im Mittelgang, fast so lang wie die Kirche, und viele Tiere und Adam und Eva. Oder das Bild, wo du auf dem Dach sitzest, das erinnerte mich daran, wie wir in einem Dorf mit Trulli-Häusern gehalten haben und ich durfte auf einem ganz engen Stägeli aufs Dach. Die Frau hat gesagt, ich solle ruhig kommen. Oder die Karte, wo ihr alle zusammen unter der Pergola esst: Weisst du noch, dort, wo wir immer in die Sommerferien gingen, als ihr noch kleine Kinder wart, hatte es auch eine Pergola, unter der wir gegessen haben. So kommt mir halt mit den Bildern einiges wieder in den Sinn.
Wenn es wieder etwas lockerer ist mit der Pandemie freue ich mich auf deinen Besuch, aber wann das sein wird, das wissen wir leider nicht.
Billy hat ein blaues und ein braunes Auge. Auf einem unserer ersten Spaziergänge hat mir ein Nachbar gesagt, dass sie aussieht wie ein Husky, einfach in Miniformat. Das stimmt, Billy hat was von einem Husky, nicht nur wegen ihrem schönen Köpfchen und den Augen, sondern wegen ihrem stolzen und eigenwilligen Charakter. Sie weiss ganz genau, was sie will, und fordert mich jeden Tag aufs Neue heraus. Billy begleitet mich, egal wohin ich gehe, sie ist neu, gehört aber doch schon so fest zu mir. Ich würde sie nie mehr wieder hergeben.
Vor ein paar Wochen bin ich an den Markt gegangen, mit dem Auto, am Samstag. Da sah ich sie. Ich habe mich erschrocken, dachte, dass sie ein alter, blinder Hund sei. Wegen dem blauen Auge. Man könnte sagen, ich habe nicht gezögert, aber das tönt, als ob ich mir etwas überlegt hätte, und das habe ich nicht. Ich habe das bis auf die Knochen abgemagerte, zitternde und von Ungeziefer übersähte Hündchen vom Strassenrand geschnappt, auf den Beifahrersitz gesetzt und bin nach Hause gefahren.
So etwas wie Billy habe ich noch nie gesehen, so viele Parasiten. Und ich weiss, wovon ich spreche, ich habe nun fünf Hunde, alle von der Strasse. Strassenhunde sind anders, viele meiner Hunde spielen nicht, es scheint, als ob sie zu ernst dafür wären, zu viel erlebt hätten. Sie haben ihre eigene Geschichte, wir kennen sie nicht, nur manchmal geben sie uns einen Einblick, was ihnen schon alles widerfahren ist. Ich lerne jeden Tag von meinen Hunden, bedingungslose Liebe und Treue ist für sie selbstverständlich.
Billy ist noch jung, vier bis fünf Monate. Am Anfang war sie schüchtern, nun führt sie mich an der Nase herum. Sie ist eine kleine Diebin, stiebitzt alles, was nicht nagelfest ist, jagt der Katze hinter meinem Rücken hinterher und macht sich auf dem Sofa breit. Billy geniesst nun das Leben, sie hat begonnen zu spielen, das hat mich besonders gefreut.
Teil 2. Teil 1 siehe eine Geschichte vorher.
Wenn du all den Konsum nicht mitmachst, Auto, Rauchen, Ausgang, auswärts essen, dann hast du Freiheit. Ich habe nur wenige Grundausgaben und pro Tag gebe ich zusätzlich nicht mehr als 10 Franken aus. Wenn’s mal mehr sind, dann am nächsten Tag halt weniger. Heute habe ich Steinpilze gekauft. 7 Stutz. Geld habe ich immer als Bargeld im Sack. Wenn ich etwas kaufe, muss ich ein Zehnernötchen aus dem Portemonnaie nehmen, dann überleg ich’s mir doppelt. Ich habe mir jetzt neue Trainingsschuhe gegönnt. Einen Monat habe ich mit dem Kauf gewartet, lange überlegt, aber dann gedacht, doch ja, sie gefallen mir. Von meiner Schwester bekomme ich auch einmal im Jahr Schuhe geschenkt. Aber die benutze ich erst, wenn meine alten kaputt sind. Zwei stehen jetzt in einer Schachtel und warten noch darauf, benutzt zu werden.
Beim Einkaufen nehme ich nie einen Einkaufskorb. Ich kaufe nur, was ich mit den Händen tragen kann. Ich weiss immer ganz genau, was ich kaufen will, ein Joghurt, eine Thunfischbüchse. So kauft man nie mehr ein, als man braucht.
Ich trainiere sechsmal pro Woche. Ich backe mir meine eigenen Proteinriegel, die gekauften sind teuer und es ist nur Mist drin. Mein Grundrezept ist einfach: Nüsse, Beeren, Wasser, Hafer, Proteinpulver, Schoggi- oder Vanillepulver oder manchmal Kokosnuss, das wird dann fast wie ein Bounty. Für ein Blech zahle ich vielleicht 30 Franken. Pro Tag esse ich 2, ein Blech reicht also für 12 Tage.
Nach der Realschule habe ich eine Lehre als Koch gemacht. Meinen ersten Lohn gab es bar auf die Kralle, 1700 Stutz. Dann habe ich gemerkt, wie das Geld immer schnell weggeht. Handy kündigen, Krankenkasse nur noch die Grundversicherung und so weiter. Ich habe gemerkt, wenn ich wenig ausgebe, dann bleibt viel Geld übrig.
Der Unterschied zu anderen Leuten ist, ich verdiene voll, aber lebe das Leben eines Lehrlings. Das Ersparte habe ich zuerst in Materialien für meinen Raum investiert. Als nächstes habe ich mit meinem Kumpel eine Kamera und eine Drohne gekauft, für unsere Kurzfilme vom Breakdancen. Da haben wir überhaupt nicht gespart, die beste Qualität genommen. Jetzt verwenden wir das gesparte Geld für eine Reise. Zwei Jahre gehen wir nach Asien, vielleicht auch zweieinhalb, vielleicht kommen wir gar nicht mehr wieder. Luxus ist für mich, wenn ich mich immer wieder aus der Gesellschaft ausklinken kann.
Lebe ich mein perfektes Leben? Es muss nicht perfekt sein, ich bin kein Freudenmensch, der immer begeistert oder überglücklich sein muss. Das Leben nehme ich gelassen. Es läuft einfach gut, ich bin nicht unzufrieden, ich nehme es so, wie’s kommt.
Teil 1. Teil 2 folgt.
Mein Kumpel und ich brauchten zuerst eigentlich einfach einen Trainingsplatz und einen Ort fürs Breakdancen. Wir sahen eine Anzeige für einen Raum in einem Neubau, neben der Waschküche, ohne Fenster. Wände, Boden und Decke aus Beton.
Zuerst haben wir einen Boden fürs Breakdancen verlegt. Dann haben wir eine Hantelstation gebaut. Die Wände haben wir zu Kletterwänden umfunktioniert. Dann hatten wir die Idee, einen zweiten Stock zu bauen. Wir mussten zuerst rausfinden, wie so etwas überhaupt geht. In den Winterferien haben wir zwei Wochen durchgearbeitet. Um raufzukommen, muss man einen Klimmzug machen. Oben haben wir Stück für Stück ein Wohnzimmer aufgebaut, Möbel gezimmert, Stühle und Tische, eine Bar. Ein Kumpel hat uns ein schönes Stück Holz gebracht, damit haben wir eine Bartheke gemacht. Das war übrigens alles learning by doing. Damals in der Realschule hatte ich Werken und Handarbeit und schon in meiner Jugend habe ich an Töffli rumgemecht, Motoren auseinandergenommen und frisiert.
Dazu haben wir Kunstprojekte gemacht, zum Beispiel aus alten Glühbirnen. Im Moment bin ich dran, die eine Mauer mit Eierschachteln zu verkleiden und dann zu betonieren. Das sieht cool aus. Auf einer Asienreise waren wir immer im gleichen Café, wir fanden das Logo geil und haben es eins zu eins aus Holz nachgeschnitzt, das schmückt jetzt die Bar.
In Asien haben wir oft in Schlafkapseln übernachtet, nur 70cm breit. In unserem Raum haben wir uns je eine Kapsel gebaut, mit Steckdose, und jeder baute seine Kapsel so aus, wie er wollte.
So haben wir Jahr für Jahr immer Upgrades gemacht. Die Materialien kaufen wir zusammen und teilen sie durch zwei, wir hatten noch nie Streit. Jetzt haben wir so ziemlich alles, aber wenn wir von unserer nächsten Reise retour kommen, reissen wir den ganzen Boden raus und ersetzen ihn durch einen hochwertigen Boden. Im Kraftbereich verlegen wir dann einen erhöhten Kautschukboden, damit die Hanteln den Boden nicht beschädigen.
In unserem Raum hat jedes Objekt einen Zweck und alles eine Geschichte. Wir möchten nichts neu kaufen. Das Ziel ist immer, etwas zu bauen, das mindestens 20-30 Jahre hält. Bis jetzt ist uns noch nichts durch Zeit oder Abnützung kaputtgegangen. Einige Sachen haben wir einfach umgebaut. Als wir den Tisch nicht mehr brauchten, haben ihn wir ihn auseinandergenommen und zu einem Hocker umgebaut. Wir bauen alles mit Massivholz. Das ist schöner und robuster als Schrottmöbel aus Spanholz. Massivholz ist auf die lange Sicht auch nicht teurer.
In der Küche haben wir übrigens 2 Metallschüsseln, 2 Gabeln, 2 Messer, 2 Löffel, 2 Paar Stäbchen. Wir bewahren alles in Joghurtgläsern auf. Für Besucher haben wir kleine Löffelchen für den Espresso. Die meisten können es kaum glauben, was wir aus dem Raum gemacht haben.
In Zukunft wollen wir noch einen zweiten Raum mieten, gleich nebenan. Dort würden wir entweder einen Werkraum machen, eine Nasszelle oder einen Ofen reinbauen, damit ich meine Sportriegel dort backen kann.
Wenn mir ein Kleidungsstück verleidet ist oder es nicht mehr zu meinem Leben passt, aber in gutem Zustand ist, dann mag ich es nicht einfach in eine Lumpensammlung geben. Ich finde Kleidersammlungen lieblos, die man mit Schuhen, Anzügen, Unterwäsche und alten Handtaschen füllt und dann den Sack dann vor die Türe stellt, wo er abgeholt oder von Füchsen aufgerissen wird. Und intakte Kleider in die Abfuhr zu geben, brächte ich auch nicht über mich. Es ist mir ein Anliegen, dass gute Stücke weiterverwendet werden können.
Mein verstorbener Mann zum Beispiel besass viele schöne Anzüge von guter Qualität. Kurze Zeit nach seinem Tod kam ich an einem öffentlichen Anlass an der Zürcher Hochschule der Künste mit einer Frau ins Gespräch, die mir erzählte, dass sie der ZHdK jeweils alte Anzüge ihres Mannes und ihrer Söhne zur Verfügung stelle. Viele junge Kunst- und Musikstudenten könnten diese gut gebrauchen, sei es für Bewerbungen um Jobs oder auf der Bühne. Das fand ich eine geniale Idee und setze mich sofort mit dem Sekretariat in Verbindung. Dieses war sehr angetan von meinem Angebot. Ich wusste auch, dass die Anzüge für junge Männer gut geeignet waren, da mein Mann sehr schlank war. Man fragte mich sofort, wann die Kleider abgeholt werden könnten und wir einigten uns auf die folgende Woche. Ich stellte alles auf den vereinbarten Termin zusammen. Zu meiner Überraschung fuhren sie mit einem Auto mit Anhänger vor, in den man alles schön und knitterfrei hineinlegen konnte. Ich war richtig gerührt und happy, die mit vielen Erinnerungen verbundenen Stücke in gute Hände zu geben. Und hatte erst noch das Gefühl, eine gute Tat begangen zu haben. Es erleichterte mir den Abschied. Die Anzüge hatten nun ein neues, aufregendes Leben vor sich. Wenn ich an einem Anlass an der ZHdK war, schaute ich manchmal, ob ich einen Anzug meines Mannes erkenne.
Inzwischen haben sich die Zeiten auch für mich geändert. Meine Berufstätigkeit war bis vor einigen Jahren ein guter Grund, ab und zu neue Kleider zu kaufen. Nachträglich muss ich mir eingestehen, dass solche Käufe oft kompensatorischer Natur waren, im Sinne von: «Ich habe mir etwas Gutes verdient». Gelegentlich waren es auch Trost-Käufe. Das ist mir erst in meinem neuen Leben richtig bewusst geworden. Ich habe immer noch Freude an schönen Kleidern, aber heute kommt mir eher in den Sinn, dass in meinem Kleiderkasten schon etwas ähnliches hängt. Die Moral der Geschichte? Ein ausgeglicheneres Leben ist auch ein Beitrag an eine umweltfreundlichere Welt.
Diese Erkenntnis hat mich auch dazu gebracht, einen vollen Überseekoffer mit gut erhaltenen Kleidern in einen Second Hand Laden zu bringen, wo man sich aufrichtig über die guten Stücke freute. Das hat mir das Loslassen leicht gemacht. Heute bin ich froh, dass ich nicht ständig Kleiderbügel suchen muss, weil alle besetzt sind.
Ich fühle mich hier in Zürich viel relaxter. Ich liebe es, auf der Badenerstrasse einen Traktor zu sehen, all die Parks, Wälder. Als ich hier ankam, fragte mich mein Freund: schwimmt ihr auch in der Seine? Und ich musste lachen, hast du schon mal die Farbe der Seine gesehen?
Ich bin in Paris aufgewachsen, arbeitete im Marketing. Dort ist es schnell, individualistisch und es hat viele Menschen. Ich kam hierher, um herunterzufahren, Zeit zu haben, mich zu fragen, weshalb tue ich dies oder das. Weshalb ist die Welt so, wie sie ist, was können wir machen, um sie besser zu machen? Ich finde, hier in der Schweiz sind die Menschen viel offener für Veränderung. Ihr seid eben auch mit der Natur aufgewachsen, das ändert die Sicht auf die Dinge. Manchmal hat gibt es vielleicht ein wenig viele Regeln. Aber die Leute respektieren einander, sind höflich. Und wow, ich liebe die Grösse der Gebäude hier, sie sind nicht zu gross. Auch wenn ich finde, Paris hat die besseren Architekten.
Ich war sehr glücklich hierherzukommen. Ich fühle mich frei zu tun, was ich möchte, die Person zu sein, die ich bin. Zum Beispiel mehr mit meinen Händen zu arbeiten. An einem Workshop lernte ich, wie man seine eigene Zahnpasta macht und sein eigenes Deo. Das ist was für mich, wusste ich sofort, und so wurde ich Teil der Umweltplattform, die das organisiert hatte. Wir organisieren Popup-Events zu Umweltthemen. Alle zwei Monate legen wir ein neues Thema fest, den Ort, das Programm, die Partner, und dann organisieren wir das mit vielen Freiwilligen zusammen von null an auf. Nächste Woche machen wir etwas zu Foodwaste, wie man seine eigenen Essiggurken machen kann, wenn es im Sommer zu viele Gurken hat. Es geht nicht darum, den Finger auf Menschen zu richten, es geht darum zu inspirieren, etwas für sich und den Planeten zu machen. Wir versuchen alles positiv zu machen, lustig, das wirkt viel besser.
Mein erster Event, den ich organisiert habe, ist mir besonders in Erinnerung geblieben, ein Disco-Brunch. Wir organisierten einen Brunch mit geretteten Lebensmitteln und mit einer Band. Es war unglaublich, 70 Leute kamen. Natürlich viele erstmal für die Musik und das Gratisessen, aber dann sassen sie eben zwei Stunden mit uns zusammen und wir hatten die Gelegenheit, mit ihnen über Food Waste zu sprechen. Dann folgten viele andere Events, zu Urban Gardening, Kreislaufwirtschaft…
Die schönste Veränderung meines Umzugs nach Zürich ist der Wechsel von der Metro aufs Velo. Langsam unterwegs zu sein macht so einen Unterschied. Man ist fähig, anzuhalten und etwas anzuschauen. In der Nähe des Schwimmbads Letzigraben haben zum Beispiel alle Strassen Blumennamen. Das würde mir nie auffallen, wenn ich mit dem Tram unterwegs wäre. Auch mit dem Bus gehst du immer denselben Weg. Mit dem Velo kannst du am Morgen auf der einen Flussseite fahren und am Abend auf der anderen.
Dieses Jahr waren ja alle mehr oder weniger hier festgebunden, wir fanden, das ist die perfekte Gelegenheit, langsame Mobilität zu fördern, Velo, Skateboard, zu Fuss, ganz CO2-frei. Wir organisierten 20 Slow Safaris in der ganzen Schweiz. Die Leute machten eine Schatzsuche, gingen von Ort zu Ort. Ich kreierte die Safari in Zürich. Die Route führt durch meine Gegend, dort, wo ich wohne. Sie erzählt die Geschichte der Strassen im Quartier, des kleinen Ladens, der Natur. Wir haben zum Beispiel eine Bank, die heisst Bermudadreieck. Leute lassen Dinge dort, die man mitnehmen kann. Ich nahm auch schon eine Teekanne und liess einen Blumentopf dort. Auch wenn man schon 25 Jahre an einem Ort wohnt, gibt es immer wieder Ecken, die man nicht kennt, eine grossartige Aussicht, die man noch nicht entdeckt hat. Es gab auch ein Quiz, man musste rausfinden, welche Burgen, Seen oder Schluchten in der Schweiz zu finden sind. Und wir merkten, oh wow, man muss nicht nach Nordamerika gehen für schöne Seen, vieles haben wir hier vor unseren Augen. Das ist ein Teil der Lösung. Öffne deine Augen und sieh, was um dich herum ist.
Ich forschte mehrere Jahre zum Thema nachhaltige Bodenbewirtschaftung in Tadschikistan. Wir haben einen partizipativen Ansatz ausprobiert, Doktoranden aus der Schweiz zusammen mit Doktoranden aus Entwicklungsländern. Ich hatte das Gefühl, wirklich einen Beitrag leisten zu können. Dann kam ich zurück in die Schweiz an die Uni, voll in den Karrierestress rein. Plötzlich galten andere Regeln: sich im Dschungel der Vorschriften bewegen, Networken, Gelder reinholen… Ich vermisste dieses Füreinander-Einstehen, das ich während meiner Feldforschung so geschätzt hatte. Ich fing an mit dem System zu hadern, der steilen Hierarchie, den unsicheren Anstellungsbedingungen, die es gar nicht zuliessen, dass sich Teams bilden konnten. Und den Widersprüchen in unserer Arbeit. Für zehn Tage nach Zentralasien fliegen, um den Menschen zu erzählen, sie sollen mehr Bäume pflanzen, das fand ich schwierig. Ich kam nicht nur beruflich, sondern auch privat an meine Grenzen, als unser Kinderwunsch nicht in Erfüllung ging. Ich merkte, ich muss jetzt einen Schritt machen, weg, auf die Alp…
Seit Anfang 2016 habe ich beim Aufbau der Genossenschaft Basimilch geholfen. Auf einem Bauernhof in Dietikon produzieren wir Milchprodukte und verteilen sie jede Woche an die Abonnentïnnen. Das war am Anfang ein riesiger Krampf. Aber ich war topmotiviert, bin voll im Projekt aufgegangen. Ich wollte unbedingt ein Team mitkreieren, füreinander da sein, nachhaltig sein, nicht im Sinn der grossen Worte, sondern beim wöchentlichen Quarkdeckel-Waschen oder Abpacken mit den vielen Freiwilligen.
Ich fühle mich freier, weil es hier noch Freiraum gibt, etwas Neues zu schaffen. Ich verdiene weniger, aber ich bin in einer komfortablen Situation, da ich vorher gut verdient habe. Das viele Geld war für mich damals eher Stress, man musste fast für ein verlängertes Wochenende nach Vals, teure Dinge tun, Kleider kaufen… Ich bin jetzt bodenständiger unterwegs. Während meiner Forschungsarbeit in andern Ländern fühlte ich mich immer sehr wohl, nicht zwischen hundert Produkten auswählen zu müssen, einfach auf dem Markt das zu kaufen, was Saison ist. Dieses Gefühl habe ich wiedergefunden.
Ich bin manchmal in einem Dilemma. Einerseits bin ich begeistert vom neuem Projekt, vom neuem Leben, den neuen sozialen Kontakten; und gleichzeitig fehlt mir ab und zu auch der sportliche Ehrgeiz der Karrierewelt. Manchmal muss ich mich vor mir selbst rechtfertigen, weshalb ich nicht an der Uni weitergemacht habe. Ich war eine der wenigen, die aus dieser Welt ausgestiegen sind. Einige Leute haben mir gesagt: du machst jetzt das, was ich mir schon lange überlegt, mich aber nie getraut habe.
Mein Leben ist jetzt vielseitiger. Ich habe neue Fähigkeiten gelernt, von denen ich gar nicht wusste, dass man sie haben kann. Handwerkliches zum Beispiel geniesse ich. Und ich geniesse es, dass man hier nicht ständig die eigene Sichtweise verkaufen muss, nicht für alles ein theoretisches Konzept im Kopf haben muss. Die Kunst der Wissenschaft, das war für mich damals ein Ideal. Aber ich habe mich recht verloren gefühlt. All diese angesehenen Leute, die immer die richtige Antwort haben auf die wichtigen Fragen. Es könnte ja auch sein, dass es nicht so eindeutig ist. Hier ist es klar: die Kühe müssen gemolken werden, ich schaue, wie es ihnen geht, ob sie richtig fressen. Alles geschieht aus einer realen Notwendigkeit heraus.
Wenn ich etwas brauche, gehe ich oft zuerst ins Brockenhaus. Für Kleider und andere Dinge, Teller, Tassen, Ersatzpfannen. Oft auch Sachen, die man in normalen Läden gar nicht findet. Kleider aus schönen Stoffen zum Beispiel, die vielleicht mal sehr teuer waren. Wenn mir der Schnitt nicht gefällt, ändere ich die Kleider ab, mal aufwändiger, mal tausche ich einfach die Knöpfe aus. Bei Brocki-Kleidern habe ich überhaupt keine Hemmungen, kreativ zu sein. Ich habe Narrenfreiheit! Wären die Dinge teurer, hätte ich sicher Hemmungen, sie zu zerschneiden oder so.
Die Dinge im Brockenhaus haben alle eine Geschichte, da habe ich viel mehr Freude, als wenn ich etwas beim Detailhändler kaufe. Ich stosse auf Sachen, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Wenn ich etwas nicht mehr brauche, gebe ich’s zurück. Wegwerfen fällt mir schwer, aber ins Brocki bringen, das geht. Ich behalte auch meistens gut im Kopf, welche Dinge ich besitze. Mein Mann hat einmal einen Test gemacht und etwas weggeworfen – innerhalb eines Monats hab ich’s gemerkt.
Im Brocki einkaufen braucht auch Geduld, denn es hat nicht immer das, was man sucht. Für spezifische Sachen muss man schon mal ein bis zwei Jahre warten. Ich nehme auch Aufträge von Bekannten an. Es macht mir ausserordentlich Freude, wenn ich dann für jemand etwas finde, zum Beispiel eine Spitzmaschine, Teller mit Goldrand oder eine Gelte. Meine Schwester sammelt Rauenstein-Geschirr, das ist so bäuerisches, blauweisses Geschirr. Ich fand einmal unter einem Stapel billiger Teller völlig überraschend zwei Rauenstein-Teller. Ich habe die für je fünfzig Rappen bekommen, sonst kosten die dreissig bis vierzig Franken. Beim nächsten Besuch habe ich meiner Schwester als Überraschung auf den Tellern Guetzli serviert. Die Teller gab’s dann quasi dazu.
Das Brocki ist für mich wie ein Eintauchen in eine andere Welt. Die Menschen und die Stimmung sind anders als sonst wo in der Stadt. Manchmal versuche ich etwas runterzumärten, etwas, wozu ich normalerweise Hemmungen hätte. Je nach Kassiererin habe ich manchmal auch Erfolg damit, falls sie grad gute Laune hat. Das Brocki ist voll von Geschichten, man sieht all die verschiedenen Sachen und es entstehen neue Geschichten. Wenn ich schlechte Stimmung habe komme ich hierher, hier komme ich auf andere Ideen und bekomme bessere Laune.
Das hat schon im Kindergarten begonnen. Ich sollte den Anzug meines Vaters in der Wäscherei abholen. Ja nicht verknittern sollte er. Die Frau in der Wäscherei gibt mir also den Anzug, aber er war so gross und ich so klein, dass er fast am Boden nachschleifte. Zuerst habe ich ihn mit einer Hand gehalten, dann nahm ich beide Hände, dann legte ich ihn über die Schulter, habe aber nichts mehr gesehen. Ich habe sicher sechzehn Stellungen ausprobiert. Irgendein Journalist hat das aus Zufall gesehen und fotografiert. Ich sah es als Wichtigstes an, die Aufgabe zu erfüllen, auf welche Art auch immer, verbissen dranzubleiben, neue Techniken auszuprobieren, bis es funktioniert.
Ich bin Unternehmer, mein Hauptgeschäft ist in der Entwicklung von intelligenten Systemen für optische Qualitätskontrolle. Aber am liebsten erfinde ich. Ein ausfahrbarer Rollstuhl, mit dem man an der Bar stehen kann, elektronisches Bandenbingo für den HC Davos, Selfie-System für den Energy-Drink-Hersteller, Chat- und Bestellsystem in der Sushi-Bar oder ein intelligenter Parkplatz-Koordinator. Es geht mir immer darum, etwas zu verbessern. Nichts ist unlösbar. Habe ich etwas entwickelt, dann gebe ich es weiter und mache etwas Neues. Ich möchte nicht mit einfach nur einer Erfindung sterben.
In meiner Freizeit spiele ich Tennis. Ich fand es schlimm, dass so viele Tennisbälle verbraucht werden, jede Woche eine neue Röhre, wenn man viel spielt. Die beste Lösung wäre, die Bälle länger zu brauchen, aber kein Tennisspieler spielt gerne mit schlaffen Bällen. Ich habe deshalb einen mechanischen Tennisballrecycler entwickelt. Das ist ein Art Röhre, die die Bälle nach dem Spielen wieder in Gegendruck bringt. Damit kann ich mit den Bällen dreimal länger spielen. Ich überleg mir jetzt eine Ballsortiermaschine, die automatisch die noch rettbaren Bälle aussortiert und gleich wieder auffrischt. Das möchte halt leider kein Laden, ist schlecht fürs Geschäft. Ich habe auch mit Tennisprofis gesprochen, aber die bekommen die Bälle gesponsert. Aber für einen Trainer könnte das etwas sein.
Überhaupt habe ich eine Vision vom Tennisplatz der Zukunft. Ich habe einen kleinen mechanischen Klicker entwickelt, mit dem kann man ein Signal aussenden. Das ist an ein Zähleranlage gekoppelt, so sieht man auf dem Display immer den Spielstand. Ein Ballroboter sammelt die Bälle, der schafft zweieinhalb Meter pro Sekunde. Eine Kamera dient als Schiedsrichter, wenn man sich nicht einig ist, ob der Ball in oder out war. Und wenn man möchte, kann man nach dem Spiel schauen, wo man überall Fehler gemacht hat. Wobei, dann sieht man womöglich, dass man vielleicht doch besser mit dem Tennis aufhören sollte… Bei den Spielerbänken steht ein Smart Fridge. Gesteuert wird alles über die Klubkarte, damit macht man auch Reservationen, dafür habe ich ein intelligentes System entwickelt. Die Energie für alles kommt von biegbaren Solarpanels über den Spielerbänken, die den Spielern gleichzeitig Schatten spenden. Für vieles habe ich schon Prototypen entwickelt, anderes ist noch in Planung. Es gibt bereits einige interessierte Tennisclubs in der Region. Und im Frühjahr durfte ich mein Konzept Rafael Nadals Vater vorstellen. Er war sehr interessiert, dann kam leider Corona.
Wenn eine Ungerechtigkeit da ist, ein Problem, dann studiere ich, was kann man besser machen. Ich überlege mir zum Beispiel einen Landgewinnungsroboter für die Wüste. Er nimmt Wasser aus dem Meer, entsalzt, pflanzt an, und begrünt so immer weiter ins Landesinnere rein. Die Energie bezieht der Roboter von der Sonne. Das ist bis jetzt nur eine Vorstellung, aber theoretisch wäre es möglich. Ich träume schon davon, mir ein Stückchen Wüste zu kaufen.
Eine Lieblingserfindung habe ich nicht wirklich, die Aktuelle ist meistens auch meine liebste. Wenn ich an einer neuen Idee rumstudiere, kann ich fast nicht schlafen. Meine neue Strategie ist jetzt, dann alles mal aufzuschreiben. Dann kann ich bis am Morgen warten.
Diese Geschichte wurde auf einer Reise entdeckt und nach Hause mitgebracht. [Aus dem Italienischen übersetzt]
Ein Quintal ist hundert Kilo. Meine Tochter und ich haben jetzt knapp ein Quintal unserer Tomaten durch diese Maschine gequetscht. Die Häute und Kernen werden dabei entfernt und das Fruchtfleisch wird zu Mus. Das füllen wir in Flaschen. Diese werden im einem grossen Zuber mit Wasser bedeckt, welches dann erhitzt wird. Es muss zirka eine halbe Stunde in den Flaschen leise blubbern, dann wird alles gut mit Wolldecken abgedeckt und ganz langsam abgekühlt. Morgen früh sind die Flaschen immer noch handwarm. Ich stelle sie zum Trocknen auf und dann in die Speisekammer.
Dieses Jahr hat es wenig Tomaten gegeben, weil es so trocken war. Im Mai hat es das letzte Mal geregnet, das war vor vier Monaten. Darum ist dieses Jahr die Salsa auch recht dick und konzentriert, die Tomaten waren einfach weniger saftig, aber dafür haben sie mehr Geschmack. Wenn ich daraus Sauce kochen werde, muss ich vielleicht sogar ein bisschen Wasser zugeben. Hier ein kleines Geschichtlein, damit ihr versteht, wie extrem trocken es ist: Bei uns wächst normalerweise ohne viel dazutun die Bietola, unser spezieller Mangold. Dieses Jahr kam aber gar nichts. Heute habe ich gerade zum ersten Mal im Leben Bietola auf dem Markt gekauft. Ist das nicht total verrückt?
Klar brauchen wir so viel Salsa, die essen wir ja fast jeden Tag. Jetzt hat es gerade noch drei Flaschen vom letzten Jahr in der Kammer. Es kann sein, dass es dieses Jahr gar nicht ganz reicht bis zur nächsten Ernte. Ausser der Salsa mache ich noch Pelati, aber wenige. Dafür brauchst du schöne, grosse Tomaten. Und dann trockne ich auch noch ein paar wenige an der Sonne. Jetzt ist es schon ein bisschen feucht in der Nacht, darum muss man die Gitter immer rein- und am Morgen wieder raustragen, es ist viel Arbeit.
Natürlich habe ich Freude, wenn die Kammer voll ist. Es hat auch Gläser mit Kapern oder Oliven, dann Säcke mit Kichererbsen und Saubohnen, natürlich auch getrocknete Feigen mit Mandeln drin und recht viel Marmelade. Und wir haben Weizen angebaut für die Orecchiette, aber auch für Brot und süssen Kuchen.
Wir nehmen Menschen bei uns auf, wegen dem Asylrecht, aus christlichen Gründen, ja, aber das macht doch nur Sinn, wenn sie auch eine Arbeit haben, eine Familie aufbauen und ernähren können, zufrieden sind. Sprache ist der Schlüssel. Wenn du die Sprache nicht hast, klappt es hinten und vorne nicht. Man merkt aber schnell, dass nicht diejenige Person besser ankommt, die den Dativ vom Akkusativ unterscheiden kann, weiss, ob es der oder die Bank heisst, sondern die Person, die unsere Lebensweise versteht. Und dafür muss man sich verständigen können.
Wir machen Deutschkurse. Deutschkurs hört sich ja zuerst einmal ganz normal an, aber wir sind keine traditionelle Schule. Unsere Lehrer kommen freiwillig, die Schüler kommen freiwillig, wir haben keinen Lehrplan. Die Lehrerïnnen haben ihre eigenen Ansätze und die Schülerïnnen wählen sich einfach die Lehrkraft aus, die ihnen am meisten entspricht. Wir haben uns gesagt: warum soll der Samstag nicht mal anders sein? Wir versuchen das humorvoll zu machen, es ist immer wieder sehr, sehr lustig.
Ich habe eine eigene Firma für Venture Capital im Medizinbereich und kann nur schwierig deutsche Grammatik erklären. Sprechen, ja, aber nicht erklären. Meine einzige Chance ist, die Fortgeschrittenen zu unterrichten, mit denen kann ich Leseverstehen machen und diskutieren. Alle Fortgeschrittenen, die sich nicht hinsetzen und Grammatik lernen wollen, kommen zu mir. Und dann wird geredet, was ist in der letzten Woche passiert, jemand war auf der Rigi, welche Berge kennt ihr sonst, vollkommen flexibel. Wir lachen viel, wenn wir übers Essen diskutieren, der Eritreer isst fünf Eier am Tag und der Tibeter nur Gemüse und der Eritreer auf keinen Fall Gemüse. Was ist euer grösster Wunsch? Der Tibeter sagt, Liebe, Friede, Freunde, und der Eritreer sagt, ein Ferrari.
Ich mache das mit Inbrunst. Wir gehen zusammen die Bedürfnispyramide durch, was ist uns wichtig? Während Corona haben wir ja immer über Systemrelevanz gesprochen, aber was ist eigentlich systemrelevant? Post, Handy, Krankenhaus, Telefon, Strom, Lebensmittelläden… und dann sagen sie: Lebensmittelläden brauchts in meinem Land keinen, weil, man baut ja selbst Essen an. Oder: für was braucht’s bei mir zuhause ein Telefon, wen soll ich denn anrufen? Wir meinen mit Systemrelevanz Dinge, ohne die wir nicht leben können, und sie gucken dich mit grossen Augen an, natürlich geht das. Wir reden auch über schwierige Themen, aber nie über ihre Flucht, ausser sie sprechen das selbst an.
Ich merke, ich schätze durch die Tätigkeit das Eigene umso mehr. In einem Land zu leben ohne Krieg, ohne zerrissene Familien. Man merkt, dass unsere strukturierte Welt mit all den Regeln nur funktioniert, weil wir keine Sorgen haben, dass uns die Kinder weggenommen werden oder wie wir ohne Gepäck in ein Land kommen, das 5000 Kilometer entfernt ist.
Ich habe das Projekt von A bis Z aufgebaut. Als die grosse Flüchtlingswelle kam, habe ich der Kirchgemeinde vorgeschlagen, irgendetwas zu tun. Das fanden alle gut. Zuerst lief es schleppend, wir hatten mehr Lehrerïnnen als Schüler. Irgendwann hat es klick gemacht, Mundpropaganda eben. In den Spitzenzeiten nutzten wir sämtliche Räumlichkeiten der Kirchgemeinde. Und mittlerweile machen wir neben dem Sprachunterricht noch viele andere Dinge, Mittagstisch, Exkursionen, administrative Hilfe, Weihnachtsgeschenke. Nur wenige Freunde verstehen die Intensität, mit der ich das mache. Wie, nach vier Jahren machst du das immer noch?
Ich helfe nicht nur anderen, ich tu mir etwas Gutes. Ich habe zwei Dinge, bei denen ich mich komplett entspanne. Wenn ich auf einem Pferd sitze und reite und wenn ich unterrichte. Du bist so bei den Menschen, du denkst an nichts anderes. Ich komme immer am Samstag nach Hause und am Nachmittag gehe ich mit meiner Frau im Wald spazieren. Ich erzähl ihr, du glaubst es nicht, was jetzt der gerade wieder gesagt hat. Mich baut das jeden Samstag so auf, was ich hier machen kann. Wir haben diesen Sommer einige Wochen im Engadin Urlaub gemacht. Immer Freitagabend oder Samstag morgens früh habe ich mich in den Zug gesetzt und bin nach Zürich, habe Unterricht gegeben und bin dann wieder ins Engadin zurück. Ich lasse den Samstag nicht ausfallen. Alles, was ich plane, plane ich um den Samstag herum. Der ist gesetzt.
Das ist total aus Zufall entstanden. Ich führte in einem Facebook-Live-Talk für Helvetas ein Gespräch mit Gabriela Manser, Unternehmerin und Erfinderin von Flauder. Wir haben miteinander über Glück und Nachhaltigkeit gesprochen, über Aufmerksamkeit und Achtsamkeit gegenüber der Welt. Irgendwie kamen wir im Gespräch darauf: Nachhaltigkeit ist ein unschönes Wort, ja, ein wüstes gar. Spontan sagte ich: Weisst du was, machen wir doch gleich einen Aufruf, ob es nicht ein besseres Wort gäbe für nachhaltig.
Das haben wir getan. Wahrscheinlich habe ich mich dann aber als einzige richtig inspiriert und verantwortlich gefühlt. Ich bin Wörter aus anderen Sprachen durchgegangen, sustainable, sostenibile, die sind auch nicht besser. Beim französischen durable bin ich hängengeblieben, das hat mir gefallen. So bin ich auf das Wort durig gekommen. Etwas, das dauert, duret, durig ist. Der Klang hat mir gefallen. Es hat irgendwie auch etwas Trauriges drin, aber das stimmt für mich eben auch. Weil es einen eben turet, man es bedauert, wenn etwas nicht durig ist. Noch nicht ganz geklärt ist die Frage nach dem Substantiv: das Durige, die Durigkeit, die Durität? Und wird es mit einem U oder zwei U geschrieben? Auf jeden Fall finde ich durig ein sehr schönes Wort. Ich glaube an Wörter. Wir sind sehr sensibel, wir spüren, was ein Wort bedeutet. Wörter machen Sinn. Chrüsele ist nicht chratze. Drum zähle ich darauf, dass ich eines Tages jemand sagen höre: Dieser Tisch ist schön durig. Und wir alle verstehen, was damit gemeint ist.
Für Esswaren, die uns noch fehlen, gehen wir containern. Das heisst, wir nehmen aus den grossen Abfallcontainern der Detailhändler Lebensmittel, die noch gut sind. Letztens habe ich in einem solchen Abfallcontainer unzählige Packungen Eier gefunden. Ein Ei ist so etwas Wertvolles. Ein Huhn produziert ein Kunstwerk, mit so viel Arbeit, Energie und Liebe dahinter.
Containern ist eine rechtliche Grauzone. Ich hatte einmal ein sehr schöne Begegnung mit Polizisten, die uns kontrollierten:
“Was tut ihr hier?”
Das habe ich ihnen ruhig und selbstverständlich erklärt.
Dann haben sie gesagt: “Zeigt mal, was für Lebensmittel ihr gerettet habt”. Und dann: “Warum wirft man denn das weg, warum nehmen das nicht zum Beispiel die Angestellten mit?”.
Am Schluss fanden sie, was wir tun macht Sinn, und sie sind weggefahren.
Als ich aus dem Iran geflüchtet bin, habe ich alles verloren, meine Familie, meine Freunde, meine Firma. Ich versuche hier ein neues Leben zu beginnen. Der Schlüssel dafür ist Sprache. Ich habe am Anfang jeden Tag acht Stunden selber in der Bibliothek Deutsch gelernt, Gratis-Deutschkurse besucht. Ich bin ein ungeduldiger Mensch, ich will meine Ziele erreichen. Seit Januar dieses Jahres mache ich eine Ausbildung zur Migrationsfachperson und bin Praktikant bei einem Projekt zur Unterstützung von Flüchtlingen. So kann ich jetzt anderen helfen.
Im Iran hatte ich eine eigene IT-Firma. Als Geflüchteter habe ich keine Chance, eine Arbeit zu finden. Aber ich kann anderen Flüchtlingen mit Computern helfen, die damit Mühe haben. Ich zeige ihnen, wo sie online Information finden. Ich sage ihnen, sie können sich selbst eine Arbeit oder Wohnung suchen, sie müssen nicht auf den nächsten Termin mit dem Sozialberater in zwei Monaten warten.
Geflüchtete Menschen haben in der Schweiz eine tiefe Lebensqualität, viele haben psychische Probleme. Lange Zeit verbringen sie in einer Asylunterkunft, essen, schlafen, warten auf einen Bescheid. Vielleicht bekommen sie von einer Hilfsorganisation ein bisschen zusätzliche Unterstützung, ein Billet, ein Buch. Das Problem ist aber grösser, dass sie nicht Teil der Gesellschaft sind. Dass sie nicht die gleichen Rechte auf dem Arbeits- oder Wohnungsmarkt haben.
Mit Corona wurde alles noch schwieriger. Plötzlich war alles zu, keine Freiwilligenprogramme mehr, keine Projekte oder Deutschkurse. Die Leute blieben untätig und sehr verunsichert in den Asylunterkünften. Wo es kein WLan gab, hatte man kaum Kontakt zur Aussenwelt. Ich habe zusammen mit Hilfsorganisationen einen Brief an die Behörden geschrieben mit Bitte um Hilfe. Aber: Nein das geht nicht, kostet zu viel Geld, dafür braucht es Sitzungen, Gespräche. Eine Zeitung wollte ein Interview über die Situation von Geflüchteten in dieser Zeit machen. Ich habe Auskunft gegeben und nach der Veröffentlichung war es doch möglich in einigen Asylheimen Internet einzurichten. In vier Asylheimen habe ich das Internet selbst installiert, dank einer Frau, die auf eigene Kosten vier Internetboxen bestellt hatte.
In meiner Kindheit lebten wir im Krieg. Da haben wir gelernt, schnell zu reagieren, wir waren immer bereit, wenn der Alarm kommt. Diese Erfahrung hilft mir, darum bin ich manchmal flexibel und schnell.
Während der Corona-Krise war es in den Asylheimen vor allem für isolierte, ältere Menschen oder Familien mit kleinen Kindern sehr schwierig, einzukaufen. Ein Freund lieh mir sein Auto aus. Damit habe ich Essen in Zürich abgeholt, wo mein Freund Amine die Aktion “Essen für Alle” gestartet hatte, da alle Gassenküchen geschlossen waren. Ich durfte so viel Essen nehmen, wie ich brauchte, und verteilte es in allen Asylzentren im Aargau. Darüber gab es einen Zeitungsartikel und dann haben sich viele Menschen gemeldet. Sie haben Kleider gespendet, Bücher, Spielzeuge, Laptops…
Wenn ich mit dem Auto in den Asylunterkünften ankam, riefen die Kinder manchmal von weit her. Ich gab ihnen Schokolade und Chips, das machte mir grosse Freude. Ich habe viele Sachen verteilt, habe die Leute gefragt, was braucht ihr? Sie haben gesagt: Dass du vorbeigekommen bist und uns das fragst, nur schon das macht uns Freude. So sind wir nicht vergessen.
Was bedeutet Glück? Die Zeit, in der ich lebe. Ich geniesse mein Leben, ich habe nicht das Gefühl, ich bin ein armer Mensch, ein zweitklassiger Mensch. Ich lebe für mich, ich bin verantwortlich für mein Leben. Viele Leute haben Angst vor Risiko, aber wenn man nichts riskiert, entwickelt man sich nicht. Ein Schiff bleibt nicht immer am Strand, ein gutes Schiff fährt aufs Meer hinaus, und wenn ein Sturm kommt und es nicht untergeht, dann sagen wir, das ist ein gutes Schiff.
Etwas, das mich glücklich macht: wenn der Quartierhof Wynegg, ein Bauernhof mitten in Zürich, mir ein SMS schickt, dass sie Leute zum Heuen brauchen. Dann spielt es keine Rolle, ob ich gerade Zeit habe oder nicht, das mache ich einfach. Gerade weil es so ungeplant ist, ist es schön. Heuen ist eine monotone Tätigkeit, aber ich mache sie gerne. Ich mag es, im Alltag immer wieder den Rhythmus zu brechen. Wenn es langsame Phasen gibt und dann wieder schnelle, Fastenzeit und Fasnacht, wenn man aus der Routine ausbrechen darf. Stress erlebe ich positiv, wenn nachher wieder eine ruhige Zeit kommt. Dann freue ich mich auf die Langeweile.
Am längsten Tag im Jahr habe ich beschlossen, ich gehe rund um Zürich, 54 Kilometer. Ich habe am Tiefenbrunnen den Sonnenaufgang und in Wollishofen den Sonnenuntergang gesehen. Dazwischen alles Mögliche, am TV-Studio vorbei, eintönige Kilometer der Autobahn entlang und an einer hässlichen Deponie vorbei. Aber die Monotonie hat auch ihren Platz, ist eben auch schön, weil nachher eine wunderschöne Strecke am Katzensee kommt. Am liebsten gehe ich, da passiert alles unmittelbar und ungeplant. Es ist die Urbewegung, nur ein paar Schuhe. Und wenn du geübt wärst, nicht einmal das.
Zuerst war da die Idee, einen Second-Hand-Laden oder einen Flohmarkt zu machen. Aber etwas ganz ohne Verkaufen gefiel uns besser. An unsere Tauschanlässe bringt man und frau die Kleidungsstücke mit und geht mit anderen wieder nach Hause. Mit Kleidern, die zwar nicht neu sind, aber für einen selbst eben doch neu. Helferïnnen vor Ort nehmen die Kleider in Empfang, sortieren und hängen sie auf. Das sieht dann aus wie ein begehbarer Kleiderschrank, deshalb heissen wir auch Walk-in-Closet. Wir wollen Abwechslung in den Kleiderschrank bringen. Anderen Leuten eine Freude machen mit den Kleidern, die man selbst nicht mehr trägt. Das Kleidertauschen ist eine nachhaltige und erlebnisreiche Alternative zum Fast-Fashion-Konsum. So können auch Leute, die sich ökologisch produzierte Kleider aus dem Bioladen nicht so gut leisten können, auf eine sehr nachhaltige Art und Weise neue Kleider bekommen.
Manche Leute haben noch das Gefühl, Second Hand ist schmuddelig, aber das ist schon lange nicht mehr so. Wir schauen sehr auf die Qualität, stimmt sie nicht, dann geben wir’s zurück. Ursprünglich war es als Jugendprojekt gedacht, aber jetzt sind wir generationenübergreifend. Bei uns kann die 17-Jährige mit der 60-Jährigen tauschen. Es gibt immer wieder schöne Momente, wenn man sieht: du hast ja mein T-Shirt an! Man kommt zusammen ins Gespräch, findet Leute mit demselben Kleiderstil, es entstehen vielleicht sogar Freundschaften.
Wir haben zehn bis zwanzig Helferïnnen pro Standort. Die meisten kommen immer wieder, wir sind eine grosse Community geworden. Am Standort Baden arbeiten jetzt seit drei Jahren auch Geflüchtete, die in der Region wohnen, mit uns zusammen. Wir haben zum Beispiel eine Helferin, sie ist echt taff und fleissig. Wenn jemand unerlaubt mehr als zehn Kleidungsstücke nimmt, kann sie das super regeln. Gemeinsam für eine gute Sache zu arbeiten, macht Freude. Es macht mega Spass, andere Leute mit Begeisterung anzustecken, Begegnungen zu schaffen, gemeinsam etwas zu schaffen. Ich glaube, das ist für mich fast der Hauptmotivator. Und natürlich das super Plus am Ganzen: Kleidertauschen ist gut für die Umwelt und wir haben an unseren Events die Möglichkeit, Menschen über die sozialen Ungerechtigkeiten in der Textilindustrie zu sensibilisieren.
Bevor ich mich vor acht Jahren zu engagieren begann, war mir überhaupt nicht bewusst, mit welch riesigen ökologischen und sozialen Belastungen Kleider verbunden sind. An Kleider denkt man ja nicht als erstes, wenn man über Umweltprobleme oder soziale Gerechtigkeit nachdenkt. An unseren Tauschanlässen macht Public Eye deshalb immer einen Stand, wo wir informieren, wie Kleider im Allgemeinen produziert werden, unter welchen Bedingungen für die Näherïnnen, mit welchen Konsequenzen für die Umwelt. Das war von Beginn weg unsere Idee: auf der einen Seite eine konkrete Alternative anbieten, auf der anderen Seite zum Reflektieren anregen. Dass man sich das nächste Mal, wenn man im Laden ist, vielleicht nochmals fragt, ja brauch ich das wirklich, gefällt’s mir in einem halben Jahr auch noch?
Das Projekt wächst immer mehr, wir haben jetzt bereits 20 Orte, wo wir Kleidertauschbörsen organisieren. Und wir wollen Expertinnen werden zum Thema Kleiderproduktion, mehr kommunizieren, informieren, auch online. Für mich ist es ein riesiges Privileg, etwas mit Leidenschaft machen zu können, mit Menschen, die eine ähnliche Haltung haben. Natürlich gibt es auch Zeiten, die sehr anstrengend sind. Es ist ein selbständiger Job, ich habe gemeinsam mit meiner Stellenpartnerin die Hauptverantwortung. Können wir das Projekt in diesem Rahmen gewährleisten, kommt’s gut, kommt’s nicht gut? Das sind halt so Gedanken. Dafür habe ich sehr viel Freiheit. Und ich darf mir immer wieder neue Dinge beibringen, Teamleitung, Personaladministration, Buchhaltung, Social Media… Wir sind uns einig, wir möchten unbedingt immer eine Non-Profit Organisation bleiben, Geld immer in neue Projekte stecken. Das passt einfach besser zu uns und Ideen haben wir viele.
Die Eingangstreppe war mal ein Stein am Bahnhof. Der Badezimmerspiegel, das Tischservice und eine Leuchtstoffröhre sind aus einem Hotel. Die Kellertüren aus einem Durchgangsheim, die Ziegel vom Dach der alten Scheune vis-a-vis, der Kachelofen aus einem Chalet, Fenster, Wasserhähnen oder Ofentürchen aus anderen Häusern. Die Steinwolle zur Isolierung der Zwischenwände aus einem Asylheim. Der Tisch war mal Sperrgut an der Strasse, die Bank gefunden in einer Scheune, von einer alten Sonntagskutsche. Fassade und Fensterbank sind aus Holz aus unserem eigenen Wald. Ich weiss von jedem Stück, wo es herkommt.
Der Plan war ein Einmannhaus, eine Baracke, möglichst günstig. Dann kam meine Frau in die Quere und damit ein anderes Budget. Aber den ursprünglichen Plan habe ich weiterverfolgt, ein Haus zu bauen mit Material aus Abbruchhäusern. Beim Vorbeifahren sieht man, wenn sie beginnen, ein Haus abzubrechen. Ich wartete, bis der Abbrüchler dort war und fragte, kann ich das oder das haben. Die Leute hatten Freude, waren froh, dass sie die Dinge nicht entsorgen mussten. Zehn Jahre lang habe ich Materialien gesammelt und in meiner Werkstatt, dem alten Schweinestall, gestapelt. Wir haben alle Stücke sorgfältig ausgesucht. Wir wollten keine Musterzentrale, nichts Zusammengewürfeltes, sondern etwas, das zusammenpasst. Zu meinem 50. Geburtstag hat mir mein Schwager dann das Haus gezeichnet, ganz am Schluss, um das Material herum. Wir mussten ja zuerst wissen, wie gross die Türen oder Fenster sind.
Zeitmässig hat der Bau jeden Rahmen gesprengt, zweieinhalb Jahre lang habe ich gebaut. Aber dafür hatte ich nie einen Hänger. Ich habe fast alles selbst gebaut, nur für die heiklen Dinge hatte ich Baumeister, Sanitär, Stromer und Holzbauer. Alle waren aus dem Dorf. Wenn ich sie gefragt habe: muss ich das koordinieren, meinten sie, neinein, das machen wir zusammen beim Znüni. Sie waren nicht unter Druck, wussten, dass sie gute und sorgfältige Arbeit machen durften. Wenn sie auf anderen Baustellen eine Lücke hatten, haben sie bei mir weitergemacht. Man hört ja Geschichten: ein Haus baust du nur einmal, was für ein Stress. Aber wir hatten nur gute Stimmung auf dem Bau, alle fanden das Projekt lässig. Wir finden, diese Atmosphäre spürt man auch heute im fertigen Haus.
Bei der Heizung war uns klar, wir haben einen eigenen Wald, also heizen wir mit dem eigenen Holz. Die Regenwassertanks im Keller geben Wasser für Aussenhähne, WC und zum Waschen. So braucht man viel weniger Waschmittel, weil Regenwasser nicht kalkhaltig ist. Dafür braucht man eine Waschmaschine mit zwei Anschlüssen, um die Seife am Schluss mit Leitungswasser auswaschen zu können. Eine solche Profi-Waschmaschine haben wir in einem Hotelabbruch gefunden. Für den Strom hatte ich schon Jahre zuvor vorsorglich Leitungen vom Dach meiner Werkstatt zum Haus verlegt. Damals hiess es noch, Solarpanels gehen nicht, wegen dem Ortsbild. Später haben sie gesagt, da kann man jetzt eigentlich wirklich nichts mehr dagegen haben. Wir sind jetzt zu 97% Selbstversorger mit Solarstrom.
Weil wir so lange bauten, war es zu teuer, ein Metallgerüst zu mieten. Ich habe deshalb selbst eines gebaut. Aus den Planken des Gerüsts habe ich am Schluss unser Bett gezimmert. Handwerker war ich immer schon, das ist mein Leben. Schon als Bub habe ich immer Hütten gebaut. Und als Betriebsmechaniker musste ich immer improvisieren. Wenn du kein Ersatzteil hast, machst du eins mit dem Material, das du hast, das ist sehr kreativ. Für den Hausbau musste ich mich immer in einen neuen Bereich einarbeiten, wie verlegt man Plättli, wie deckt man ein Dach, wie verkabelt man ein Haus. Das war unglaublich spannend, ich habe häufig die Zeit vergessen, musste mich fast selbst bremsen, wenn ich wieder einmal den ganzen Tag auf dem Bau verbracht hatte.
An meinem Geburtstag sind wir das erste Mal im Haus aufgewacht. Seither haben wir einen Smile im Gesicht. Wir leben im besten Haus der Welt, dem genialsten, das man sich vorstellen kann. Übrigens, da wo du draufstehst, das ist der Grabstein meiner Grossmutter.
Ich war fürs Wochenende allein in Graubünden. Die Wetter-App zeigte im Laufe des Nachmittags eine heftige Schlechtwetterfront mit Gewittern an. Ich plante daher zuerst, bloss eine kleinere Wanderung an den Lai Grand zu machen. Spontan beschloss ich dann aber, die mir unbekannte, lange Tour nach Sufers über die Farcletta digl Lai Grand zu wagen. Oben angekommen, brauten sich die Wolken zusammen. Aber die dolomitähnlichen Zacken der Splügener Kalkberge waren dermassen imposant, dass es mich weiterzog über den zweiten Pass, die Alperschälli-Lücke. Mittlerweile war der iPhone-Akku leer, so dass ich nicht mehr fotografieren konnte. Aber ich musste mich eh beeilen mit dem Abstieg nach Sufers.
Auf einmal musste ich stehen bleiben. Vor mir war eine steil abfallende Geröllhalde aufgetaucht, unten toste ein Bach. Da war keine Wegspur, aber ich wusste: Es gibt kein Zurück. Ich atmete tief durch. Dann machte ich sorgfältig einen Schritt nach dem andern. Mein Kopf war ganz ruhig und fokussiert, der Körper funktionierte zuverlässig. Als ich den Steilhang traversiert hatte, blickte ich zurück und realisierte, wie exponiert die Stelle tatsächlich war. Ein Glücksgefühl erfasste mich. Beschwingt setzte ich den Abstieg fort. Unten angekommen, schien die Sonne. Bevor ich in Sufers ins Postauto stieg, ass ich einen Coup Dänemark.
Ich war trotz der sehr langen und anstrengenden Wanderung überhaupt nicht müde, auch mein Geist war hellwach. Sie war ein Schlüsselerlebnis, das bis heute nachhallt und mich trägt: Ich hatte etwas gewagt, von dem ich nicht wusste, wie es ausgeht, und dabei meine Seelenruhe gefunden.
Der erste Abfall, der überhaupt je produziert wurde, entstand beim Big Bang. Wadadumm und wumm hat’s gemacht und seither fliegen die Brocken durchs All. Das fasziniert mich unglaublich, die Entstehung des Universums bis hin zur Entstehung der Erde und des Lebens. Es ist ein Wunder, und nun lebst du dein kleines Leben und willst dem einen Sinn geben. Als Teil der Herde willst du nützlich sein und eine Tätigkeit wählen, die dich erfüllt. Mehr kannst du nicht wollen. Eigentlich bin in ja pensioniert, schneide die Hecke, lese Äpfel vom Boden auf, gehe auf den Markt und kaufe neue Pfefferminzpflanzen, nachdem sich die lieben Schnecken an meinen gütlich getan haben. Und dazwischen schreibe ich. Ich bin Geologe und habe mich das Leben lang mit Abfall beschäftigt.
Jetzt bin ich an einem Artikel, der mir Bauchweh macht, über ein Sonderabfall-Endlager in Süddeutschland, das derzeit erweitert wird. Viele der Abfälle, zum Beispiel Quecksilber oder Arsen, sind bekannterweise hochgradig toxisch. Früher hat man die in Oberflächendeponien gelagert. Dann kam es zu Vergiftungen und so beschloss man, einen Stock tiefer zu gehen, 200 bis 800 Meter in den Boden. Das ist Steinzeit, aber Entschuldigung, ich sollte die damaligen Menschen nicht beleidigen. Man will also unsere Industrieabfälle in einem alten Salzbergwerk verbuddeln, Dutzende von Millionen Kubikmeter an diesem Standort. Die Konsequenzen werden vielleicht erst in hundert oder zwei-, dreihundert Jahren oder später sichtbar. Irgendwann kommt das Wasser und dann werden bis einige Prozent der Stoffe ausgewaschen und das reicht, um das Grundwasser für tausende oder zehntausende von Jahren zu kontaminieren. Es ist nicht mehr nutzbar. Das widerspricht dem Grundgedanken der Nachhaltigkeit. Heute sagen die Betreiber «überhaupt kein Problem, das passiert niemals». Die Wahrnehmung der Risiken wird durch den langen Zeitraum verdünnt. Aber du weisst ja nicht, wie die Erde sich entwickelt, wie die künftigen Generationen leben und wirtschaften wollen, wie sie den Untergrund nutzen wollen. Als Mieter packst du ja auch nicht deinen Abfall unter die Bodenbretter und der Nachmieter kann dann schauen, wo er bleibt. Das ist doch keine Haltung. Richtig wäre, dass man langfristig die Weichen so stellt, dass man solche Abfälle vermeidet oder sonst so behandelt, dass die Toxizität massiv reduziert wird. Man sollte dem Planeten Sorge tragen und unsere Technik sollte dem dienen.
Ich prüfe sehr selbstkritisch, wofür ich stehe. Ich bin kein Ideologe, stelle alles immer wieder in Frage. Aber wo unsere Gesellschaft auf dem Irrweg ist, musst du den Finger draufhalten. Das habe ich immer klar und immer anständig gesagt. Am Anfang versuchen dich Interessenvertreter zu zertrampeln und zu diskreditieren. Wenn es ihnen nicht gelingt und du durchhältst, wirst du stärker. Interessant ist es auch, was Gegner schon über mich gesagt haben: Der Marcos als solcher ist ein patenter Typ, er hat nur die falschen Ideen.
Ich lese gerne, was andere Menschen auf ihrem Lebensweg gemacht haben, sehe, dass viele das Bedürfnis haben, sich zu verbinden, mit anderen Menschen und auch mit der Natur. Das macht dich als Menschen, als der du Teil der Natur bist, glücklich. In dir selber drin stecken 3.3 Milliarden Jahre Evolution. Diese Verbundenheit mit der Geschichte und den gescheiten Menschen macht mich zufrieden und glücklich. Es gibt mir den Boden, auf dem ich die Schwierigkeiten aushalte, denen ich begegne, die Umweltzerstörung und das Boshafte auf der Welt, und meinen kleinen Beitrag zu einer besseren Welt leisten kann. Ich schaue aus dem Fenster auf das schön bemalte Vogelhäuschen meiner Enkelin. Ich sehe die Spatzen und Meisen. Nachher gehe ich mit meiner Partnerin in die Pilze. Ich liebe den Abfall vom Big Bang: Schau in den Himmel und du siehst die Sterne, schau auf den Boden und du siehst die Erde.
Vor zwei oder drei Jahren habe ich einen kleinen Bericht in der Zeitung über die Rosita Wägeli aus Wittenbach gelesen und mir war gleich klar, mit einer solchen Knutschkugel möchte ich auch einmal verreisen. Die Wägeli sind einfach so heiss! Und diesen Frühling ist meine Tochter dann 50 geworden. Klar, dass wir etwas zusammen machen. Eine Frauenwoche, das ist doch etwas zum runden Geburtstag. Wir sind beide gerne am Wasser, wieso also nicht mit dem Wägeli durch die Schweiz und zum Bodensee?
Doch zuerst noch zu der Geschichte der Wägeli. Sie kommen aus der DDR. 1936 hat ein Dreiradbauer begonnen sie zu bauen. Denn damals war es immer ein wenig ein Problem, wenn ein Geschäftsmann mit seiner Sekretärin unterwegs war und dann ins Hotel zum Übernachten ging. Wo sollte die Sektretärin schlafen? Und heute gibt es noch rund 2000 solche Dinger. Die einen rund, die anderen rechteckig, so dass man meint sie fallen in der nächsten Kurve um. Die Wägeli sind ganz praktisch, sie haben eine Sitzgruppe die sich zum Bett umbauen lässt, ein Schränkli für die Kleider und sogar ein kleines Kücheli. Bei Rosita steht eine ganze Auswahl von ihnen, in allen Farben. Die Leute von da sammeln die Wägeli und machen sie wieder zwäg. Gezogen werden sie von einem Smart, das geht, weil die Dinger so leicht und klein sind.
Zuerst habe ich mich schon ein bisschen gefürchtet. Ich dachte mir, dass ich mit dem Wägeli alle Velofahrer umfahre. Ich habe mich dann doch getraut. Zur Sicherheit habe ich mir meinem Mann im letzten Herbst noch ein Probewochenende gemacht, das hat schon super geklappt. Mit meiner Tochter habe ich nach dem verrücktesten Wägeli gefragt, das ist ein Violettes mit gelben Punkten. Beim Wägeliverleih gibt es noch ein kleines Lager, in dem man sich für die Reise ausstatten kann. Wir haben uns entschieden einen leuchtenden Gartenzwerg mitzunehmen. Auch ein paar antike Tässchen und Kerzenständer kamen mit auf die Reise. Wir sind dann von Wittenbach aus sehr gut vorangekommen. Bereits auf der Strasse haben wir jede Menge Aufmerksamkeit genossen. Die Leute haben auf uns gezeigt, gewunken und mit dem Daumen nach oben gezeigt. Sogar auf der Schnellstrasse waren die anderen Fahrer sehr freundlich, das hat uns dann doch etwas gewundert, denn 80 haben wir nicht hingekriegt auch wenn es leicht abwärts ging. Auf den Campingplatz waren wir natürlich auch der Blickfang, vor allem für die Kinder. Die Leute haben sich gewundert, dass das kleine Auto ein ganzes Wägeli ziehen mag. Es gab eine richtige Völkerwanderung zu uns auf dem Campingplatz. Alle wollten schauen, wie es denn im Wägeli drinnen aussieht und noch ein Foto machen. Es gabe viele Jöös und vor allem die Kinder haben sich gewundert, ob man denn da drinnen schlafen kann. Wir haben natürlich mit unserem leuchtenden Gartenzwerg auf dem Dach, dem farbigen Sonnenschirm, den Retrolämpli und den antiken Tässli für volles Ambiente gesorgt und auch ein bisschen Show gemacht.
Gegessen haben wir meist auswärts, auf dem kleinen Rechaudherd im Wägeli war mir das dann doch etwas zu heikel. Einmal hatten wir Lust auf Glace und Espresso. Aber mit dem Wägeli parkieren ist so eine Sache. Auch wenn man nur geradeaus rückwärtsfährt, macht das Ding, was es will. Also sind wir kurzerhand aufs Trottoir gefahren. Die Leute haben auch hier geschaut und ein paar sogar geklatscht, der Restaurantbesitzer hat uns also schon von weitem gesehen und gehört. Eigentlich hätte er auch schon zu gehabt, für einen Espresso hat es dann aber doch noch gereicht. Mit dem Wägeli kommt man eigentlich fast überall durch, es ist ja nicht viel breiter als der Smart. Nicht so wie die modernen grossen Wohnmobile. So konnten wir durch Dörfli fahren und sogar die Fähre nehmen und wenns dann doch einmal eng wird sind die Leute sehr aufmerksam, machen Platz und winken sogar noch. Natürlich hatten wir auch Glück, die Sonne hatte die ganze Woche geschienen und so konnten wir unseren Cabriosmart voll ausnützen.
Mehr über die in der Geschichte erwähnte Genossenschaft El Comedor findet ihr in den Geschichten 53, 49 und 35.
In unserer Wohngenossenschaft beziehen viele Haushalte feine und umweltfreundliche Lebensmittel der Food-Genossenschaft El Comedor. Da aber nur alle drei Monate geliefert wird, muss man grössere Mengen lagern können. Gewisse Haushalte konnten das nicht. Ein paar von uns hatten deshalb die Idee, mit den Comedor-Produkten einen Selbstbedienungsladen zu machen. Wir nannten ihn den Speichär.
Alles, was wir für die Umsetzung brauchten, war ein Raum und ein wenig Startkapital. Wir hatten das Glück, dass bei unserer Wohngenossenschaft Ressourcen für gemeinnützige Projekte vorhanden sind, zum Beispiel für Coworking-Spaces, Yoga, oder ein Mini-Gym. Wir brauchten nur eine sehr kleine Anfangsinvestition für Gestelle, die Waage, Papier und Putzmittel. Und wir bekamen den Keller, der vorhin leer gestanden hatte, als Lagerraum.
Am Anfang fragten wir uns schon: interessiert das überhaupt jemand oder nicht…? Und dann kamen bereits zum Anfangsevent zwanzig, dreissig Leute. Wir haben schon viel mehr Mitglieder erreicht als erwartet und die Verkaufsmenge ist exponentiell gestiegen. Es ist halt wirklich praktisch, wenn man nicht nach der Arbeit auf dem Heimweg in den Laden gehen muss. Man ist zuhause, nimmt ein paar Taschen, leere Gläser und Container mit und geht schnell in den Speichär, auch am Sonntag oder spätabends.
Der Speichär hat immer offen. Zum Eintreten braucht man lediglich einen Türcode. Nimmt man ein Produkt, klebt man einen Kleber auf eine Produktliste. Wir übertragen das dann in ein Excel-Sheet, das automatisch berechnet, wer was und wieviel bestellt hat und ob man noch genügend Guthaben hat, um den nächsten Türcode zu bekommen. Programmiert hat das alles ein Informatiker, der bei uns mitmacht.
Den Speichär betreiben wir auf Vertrauensbasis, wir vertrauen darauf, dass die Leute die Kleber auch hinkleben. Das funktioniert gut, weil wir am gleichen Ort wohnen, uns kennen. Der Speichär verbindet, er ist etwas, das allen gehört. Bei den anonymen Selfcheckoutkassen beim Detailhändler vergessen die Leute vielleicht eher, etwas zu bezahlen…
Weil wir keine Personal- und Raumkosten haben, können wir die Produkte fast zum Einkaufspreis anbieten. Wir haben lediglich eine kleine Marge, weil wir ab und zu Verluste haben, wenn Dinge schlecht werden oder die Säcke ungenau abgewogen sind. Viele Leute haben nicht so viel Geld und im Bioladen einkaufen ist manchmal zu teuer. Bei uns kann man auch mit einem Studentenbudget einkaufen. Viele Leute konzentrieren sich bei uns auch weniger auf den Preis als in anderen Läden. Man kann eben vertrauen, dass es gute Produkte von guten Produzenten zu einem fairen Preis sind.
Und ja, alle helfen mit. Aber ein grosser Aufwand ist das nicht und das war uns auch wichtig. Man kann zum Beispiel beim Posten gleich noch den Raum staubsagen. Pensionierte helfen eher unter der Woche, wenn die Produkte angeliefert werden. Wir finden immer einen Weg, es gut aufzuteilen.
Wir sind relativ klein und erreichen noch nicht so viele Leute. Vielleicht können wir einmal einen grösseren Raum mieten und noch mehr Produkte anbieten. Aber es kann gut sein, dass das System ab einer bestimmten Grösse nicht mehr so gut funktioniert. Cool wäre es, wenn man uns kopieren würde.
Wir wollten schon länger zusammen ein Unternehmen gründen. Einer von uns hatte dann auf einer Reise ein Projekt gesehen, wo abends unverkaufte Waren aus Bäckereien gesammelt und am Folgetag unter dem Motto «Frisch von gestern» verkauft wurden. Wir waren begeistert und wussten schnell: Das machen wir. 2013 haben wir die Äss-Bar gestartet. Keiner von uns Vieren hatte eine Ahnung von der Lebensmittelbranche, zwei Freunde sind in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig, einer ist Medizinaltechniker. Diese drei sind seither als stille Teilhaber dabei. Ich arbeitete als Projektleiter im Bahntechnik – und Tunnelbau und habe von Anfang an im Nebenamt die Firma aufgebaut. Das Gewicht hat sich immer mehr zur Äss-Bar hin verschoben. Irgendwann war der Bauanteil zu klein, um die schönen Projekte zu leiten, mein letztes war im Gotthard-Basistunnel. Seit 2019 bin ich vollzeitlicher Geschäftsführer bei der Äss-Bar. Wir haben heute elf Standorte und über hundert Mitarbeitende, viele davon mit Teilzeit-Jobs.
Wir wollten nie Geld von Investoren, niemand sollte uns dreinreden. Die Äss-Bar ist gewinnorientiert, aber macht nicht auf Gewinnmaximierung. Das gibt uns viel unternehmerische Freiheit. Wir behalten im Geschäft das, was es für eine gesunde Liquidität braucht, den Rest investieren wir in die Firma. Man könnte mehr Geld aus diesem Business herausholen. Aber das wäre nicht unser Stil, es täte uns nicht gut, wir hätten andere Mitarbeitende, andere Kundinnen und Kunden, ein anderes Image und wohl auch einen anderen Geschäftsführer.
Klar, wir sind in einer Branche, wo man nicht so viel verdient, aber wir zahlen mehr als der empfohlene Branchen-Mindestlohn. Während Corona haben wir Kurzarbeit angemeldet, wir wollten keine Leute entlassen. Wir machten es so, dass die Mitarbeitenden möglichst viel Lohn bekommen. Die Sorgfalt gegenüber dem Personal sehen wir als Investition, es lohnt sich wirtschaftlich und passt eben auch zu unserer Philosophie.
Am Anfang mussten wir die Bäckereien, von denen wir die unverkaufte Ware abholen, richtig akquirieren. 2013 war Foodwaste noch ein Fremdwort, dann kam die erste ETH-Studie und es ging los. Wir konnten auf den Zug aufspringen und wurden zum Pionierunternehmen. Heute gibt es eine Warteliste, weil wir nicht mehr Kapazität haben. Ware, die entsorgt wird, hat es mehr als genug, wir sind nur ein Tropfen auf dem heissen Stein. Das zukünftige Wachstum sehen wir insbesondere durch eine Verbreiterung des Angebotes. Wir finden zunehmend andere Lieferanten, Tankstellen oder Takeaways, von dort kommen mehr Salate. Neu ist auch ein Lieferant von fertigen Menus, die laufen wir verrückt. Und auch das Catering, wo wir Essen und Trinken für Events liefern, nimmt zu.
Zunehmend wird Food Waste als Ressource entdeckt, die man kommerziell bewirtschaften kann, als Quelle für Rohstoffe, aus der man neue Produkte macht. Zum Beispiel aus Schalen von Früchten gibt es ein Fruchtkonzentrat, das man wiederum anderen Produkten beigeben kann. Oder aus Brot kann man Bier machen. Ich bin selber an einem Projekt mit der Brauerei Oerlikon dran, wo Brot 15 Prozent vom Malz ersetzt. Oder Brot als Soja-Ersatz. Oder der Trester vom Brauen wird zu Pizzateig, oder es gibt Riegel, Säfte etc. Auch die Molke vom Käsen wird heute sehr oft weggeleert, sie ist aber ein hochwertiges Produkt. Für solche Produkte braucht es oft hochtechnisierte Prozesse, es ist nicht so romantisch. Zum Beispiel muss das Brot entsalzen werden, dafür wird es aufgelöst und der Brei wird gespült. Einiges ist vielleicht nicht super, wenn man die Ökobilanz anschaut, aber es geht auch um die Philosophie und dass man den Wert von Lebensmitteln bewusst macht. Ich sehe heute eine grosse Bereitschaft für Veränderung, sowohl aus der Industrie selber, wie auch von jungen, gut ausgebildeten Leuten, die Lust haben etwas Eigenes aufzubauen. Hier sehe ich auch grosses Potenzial für die Äss-Bar. Vielleicht braucht es dafür einen eigenen Brand. Wir wollen jedenfalls nicht stehen bleiben.
Ich bin ein Forstmann, habe an der ETH studiert. Die Schweiz war ja in der Gründerzeit der Eisenbahn weitgehend entwaldet und hatte deshalb grosse Problemen mit Steinschlag, Lawinen, Murgängen, Überschwemmungen. Gigantische Aufforstungsprojekte über weit mehr als ein Jahrhundert halfen dagegen. Mein Gebirgspraktikum machte ich beim Forstdienst der SBB, teilweise in der Leventina. Ich war mit der Motorsäge unterwegs, in so steilen Gebieten, dass man alles anbinden muss, sich selber, den Benzinkanister, die Säge. Ich bekam grossen Respekt vor den Leuten, die das über Jahre machen.
Die Liebe zum Wald ist während meiner langjährigen Arbeit im Verband für Holzenergie geblieben. Jahrelang habe ich versucht, eine Waldparzelle zu kaufen. Es ist krass: Wer Wald besitzt, sitzt darauf wie die Glucke auf dem Ei. Wald hast du im Herz und im Bauch, es ist nicht rational. Mit Hilfe des Zufalls konnte ich dann doch eine Parzelle erwerben, ich bin jetzt Kleinwaldbesitzer. Zu meinem Wald fahre ich mit dem Velo oder mit meinem Oldtimer-Traktor. Einmal im Jahr fälle ich ein, zwei Bäume. Mein Försterkollege hilft, der fällt die schiefen, grösseren Bäume, die einfachen darf ich. Die ein Meter langen Rugel transportiere ich nach Hause, halbiere und spalte sie, das mache ich alles selber und von Hand. Im Garten hat es einen Dreijahresvorrat. Wir fällen immer etwas mehr als nötig und den Überschuss bekommt der Kollege für seine Arbeit. Naturallohn, diese Art der Wirtschaft fasziniert mich.
Mit dem Holz heize ich mein Haus. Ich denke viel über Naturalwirtschaft und Selbstversorgung nach, möchte auch Nahrungsmittel und Wein selber produzieren. Ich wollte ein Grundstück kaufen und ging aufs Grundbuchamt, aber oh Schreck: Die Parzellen unterstanden dem landwirtschaftlichen Bodenrecht, konnten also eigentlich nur durch Bauern erworben werden. Ich wurde aufs Landwirtschaftsamt geschickt. Dort argumentierte ich, dass ich Forstmann sei und es ja sogar ein Stücklein Wald habe. Ich durfte daraufhin tatsächlich ein Bewirtschaftungskonzept einreichen. Und ja, es es hat geklappt und ich bin jetzt Nebenerwerbsbauer.
Als erstes pflanzte ich auf dem Wiesland ein paar Edelkastanien an, ich bin damit sozusagen ein Marroni-Pionier. Marroni sind lagerbar und sind insbesondere als Schweizer Produkt sehr gefragt. Die Preise sind gut, das gibt dann hoffentlich einen schönen Zustupf. Im ebenen Teil ist der Boden sehr fruchtbar, dort möchte ich vielleicht violette Spargeln kultivieren. Wenn ich von meinen zehn Ideen die Hälfte realisieren kann, ist es ein Erfolg. Es ist schon viel Arbeit. Aber wenn ich den Leuten erzähle, was ich machen willst, sagen viele: Ich komme dann gerne zur Wümmet oder Marroniernte. Und die reden nicht nur, die machen das. Und wenn es dann total anders kommt, mache ich einfach Bio-Heu, dafür gibt es auch Interessenten.
Die allermeisten Beluga-Linsen in den Läden kommen aus Kanada, obwohl sie auch in der Schweiz gut gedeihen. Man hatte dort zur Verbesserung der Bodenqualität verschiedene Hülsenfrüchte angebaut und nun sind sie ein Exportschlager. Die Kanadier selber essen kaum davon, es ist einfach nicht in ihrer Esskultur. Ich mag Linsen sehr und wollte sie anbauen, damit ich Schweizer Linsen essen kann. Letztes Jahr konnte ich dann auf 0.78 Hektaren Beluga-Linsen ansäen und habe fast eine Tonne geerntet. Ich war völlig verblüfft, gerechnet hatte ich nur mit so dreihundert Kilogramm. Ich sass in meinem kleinen Zimmer unter dem Dachboden, als mir die Annahmestelle für die Trocknung die Zahl mitteilte, und ich dachte: Mein Gott, wo tue ich die hin? Biofarm hat mir dann ein Lager vermittelt. Diese Genossenschaft investiert viel in die Kooperation in der Branche und engagiert sich für die Vielfalt an Biohöfen und Kulturpflanzen. Für die Preisfestlegung habe ich mich an ihrem Preis orientiert, ich wollte sie nicht unterbieten, das wäre nicht fair gewesen. Den grössten Teil der Ernte konnte ich schliesslich selber direkt verkaufen, den Rest hat Biofarm übernommen.
Dieses Jahr haben wir grüne, braune und schwarze Linsen gesät. Mein Kollege und ich machen auf diesem Feld unsere Bachelorarbeit in biologischer Landwirtschaft. Wir untersuchen, welche Sorte den grössten Ertrag bringt. Darum ist das Feld jetzt ganz nach wissenschaftlichen Kriterien bepflanzt. Die Reihen mit den verschiedenen Sorten wechseln sich ab, so haben alle möglichst ähnliche Bodenverhältnisse. Linsen sind sehr zarte Pflanzen. Damit sie nicht flach auf dem Boden liegen, sät man sie zusammen mit dem kräftigen Leindotter. Die Linsen hangeln sich an seinen Stängeln hoch. Zum Teil hat es sehr viel Unkraut, besonders bei den Braunen. Von denen bekamen wir keine Saatware und behalfen uns mit normalen braunen Linsen, die sonst auf den Teller kommen, sogenannter Verzehrware. Für diese gelten tiefere Kriterien bezüglich der Reinheit, es kann also schon sein, dass wir das Unkraut selber mit ausgesät haben. Es ist deshalb noch unklar, wie gut wir die Erträge der drei Sorten vergleichen können.
Zum Jäten kommen oft ein paar Kolleginnen und Kollegen, so kommt man recht schnell vorwärts und es ist auch nicht langweilig. Die Pflanzen bilden jetzt einen dichten Teppich, man sieht eine fast geschlossene Fläche, die Reihen sind kaum mehr erkennbar. Vor dem Ernten müssen wir die Pflanzen so auseinanderfädeln, dass man die Zwischenräume wieder deutlich sieht. Dazu fährt man mit der Hand nahe am Boden zwischen die Reihen und legt die Pflanzen zur Seite, wie wenn man einen Scheitel zieht und die Haare auf beide Seiten verteilt. Im Scheitel muss der Mähdrescher fahren, damit die verschiedenen Linsensorten nicht gemischt werden, was natürlich sowohl für die Bachelorarbeit als auch den Verkauf schlecht wäre. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie es mit der Ernte läuft.
Für mein Produkt habe ich keine Vollkostenrechnung gemacht und meine Arbeit zudem nur sehr knapp berechnet. Ich brauche nicht viel Geld, darum passt es schon. Wenn ich bei den Linsen auf dem Feld bin, geht es mir gut. Es macht mir nichts aus, wenn ich lange an etwas dran bin, an dem ich den Plausch habe. Ich würde gerne nach dem Studium etwas mit Landwirtschaft machen, es gefällt mir, Nahrungsmittel zu produzieren. Es gibt viele Spezialkulturen, die spannend zum Anbauen wären, zum Beispiel Ingwer, Soja, Quinoa, Lein, Kichererbsen, für Hanf und Mohn braucht es eine Bewilligung. Aber ich möchte nicht, dass ich vom wirtschaftlichen Druck zu stärkerer Rationalisierung gezwungen werde. Ich habe auch eine Ausbildung als Fachfrau Gesundheit gemacht und arbeite neben dem Studium bei der Spitex, was mir gut gefällt. Vielleicht kann ich ja beide Berufe parallel ausüben und gewinne damit Freiheit beim Bauern.
Geschichte Nr. 3 aus unserer Reise ins El-Comedor-Universum. Geschichte Nr. 2 über die Erfahrung einer Bestellerin gibt es hier, Geschichte Nr. 1 über den Hintergrund von Comedor könnt ihr hier lesen.
Nachdem ich mein Studium der Agronomie abgeschlossen hatte, kehrte ich für eine neue Arbeit wieder nach Zürich zurück. Für diese neue Lebenssituation habe ich bewusst nach neuen Wohnmodellen Ausschau gehalten. Ich wohne jetzt in einer 7er-WG im Hunziker Areal in Oerlikon. Gemüse beziehen wir über Gemüsegenossenschaft «Mehr als Gmües», Milchprodukte über die kooperative Käserei «Basimilch» und haltbare Esswaren über die Food-Genossenschaft «Comedor». Essen ist ein Grundpfeiler unserer WG, viel unseres Zusammenlebens passiert am Esstisch oder hat sonst mit Essen zu tun.
In meine aktive Rolle bei Comedor bin ich eher zufällig reingerutscht. Ich hatte mir fürs Helfen am Verteiltag direkt vor meiner Haustür frei genommen. Beim Aufräumen kam ich mit jemandem aus der Betriebsgruppe ins Gespräch und da hat sich die Idee ergeben. Schon seit Anfang Studium war mir die Achse Umwelt – Landwirtschaft – Konsum sehr wichtig. Mein Engagement sehe ich als Engagement über professionelle Interessen hinaus. Ich komme in Kontakt mit vielen spannenden Leuten und es ist eine Abwechslung zum Job. Natürlich arbeite ich auch in meiner Arbeit mit anderen Leuten oder im Team, ein Grossteil ist jedoch Einzelarbeit im Feld und im Büro. Ich finde es sehr schön, die Dinge mit anderen gemeinsam zu tun.
Comedor ist etwas hinter dem ich stehen kann. Die Mitglieder, unsere Produzenten und die Genossenschaft versuchen eine gerechtere und nachhaltigere Wirtschaft zu fördern. Ich erinnere mich an eine Branchentagung der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Der Redner, ein junger Landwirt, nahm eine Schnur, zeigte auf die beiden Enden und sagte: das eine Ende sind die Produzenten, das andere die Konsumenten. Dazwischen liegt die ganze Handelskette. Dann hat er die beiden Enden zusammengefügt und gesagt: das muss man tun. Genau das versucht Comedor, wir bringen Produzenten und Konsumenten näher zusammen. Das kann für beide Seiten viele Vorteile haben. Wir verbinden Personen in sehr unterschiedlichen Lebensrealitäten. In der Zusammenarbeit merke ich immer wieder, dass wir trotz allen Unterschieden sehr viele Werte teilen.
Heute haben wir uns über die Klimastreikenden unterhalten und darüber, wie weit wir selber gehen würden im Kampf für eine wichtige Sache. Dazu kam mir eine alte Geschichte in den Sinn. Ich war in Deutschland auf der Uni, als Studiengebühren eingeführt werden sollten. Man wollte etwas dagegen machen und ein paar Dutzend Leute haben dann die Uni besetzt. Ich auch. Ich hatte Lust, einmal etwas richtig Radikales zu tun und kam mir ziemlich revolutionär vor. An den Erfolg glaubte ich zwar nicht so ganz, aber trotzdem fand ich es gut, dabei zu sein.
Wir sind einfach an einem Abend, als das Gebäude geschlossen wurde, nicht rausgegangen. Wir sassen da und die Unileitung kam ein paar Mal und sagte, wir sollen bitte gehen. Sie müssten uns sonst durch die Polizei entfernen lassen. Wir warteten ab. Spät in der Nacht sahen wir Schatten vor den Fenstern und wussten, dass nun die Räumung bevorstand. Es entstand eine Diskussion, wie wir uns verhalten sollten. Einige von uns wollten, dass wir uns mit den Armen unterhaken und es damit schwerer machen sollten, uns einzeln abzutransportieren. Die Polizisten kamen und sagten, dass es halt einfach mühsamer, langwieriger und eventuell auch schmerzhafter werden könnte, wenn wir uns aneinander festklammern. Aber die Mehrheit wollte das gar nicht.
Ich wurde schliesslich von zwei Polizisten aus dem Raum getragen. Bei der Treppe setzten sie mich ab und fragten, ob ich nicht lieber laufen wolle. Sie boten an, dass sie mich dann vor dem Ausgang wieder tragen würden, dort wo die Presse und die Zuschauer es sehen. So haben wir es auch gemacht. Ich fand es angenehmer für beide Seiten, und die Polizisten waren auch sehr nett. Sie meinten, dass sie es richtig fänden, gegen die Studiengebühren zu demonstrieren, und wenn sie nicht bei der Polizei wären, würden sie vielleicht sogar mitmachen. Sie haben mich also vor der Uni ein Stück weit getragen, die Fotografen haben ihre Bilder bekommen und dann wurde ich von einem anderen Team im Auto nach Hause gefahren. Man wollte uns vermutlich einfach so weit wie möglich forthaben. Auch auf der Heimfahrt war die Unterhaltung sehr freundlich.
Meine Mitbewohnerin wurde ebenfalls nach Hause gebracht, aber diese Polizisten waren ziemlich aggressiv und haben sie angeschnauzt wegen den Kosten, die durch die Besetzung entstanden seien. Auch andere Mitstreiter haben berichtet, dass sie zum Teil recht ruppig oder herablassend behandelt wurden. Wir haben uns gefragt, ob ich einfach Glück hatte mit meinen Polizisten, oder ob es an meiner sehr grossen Kooperationsbereitschaft lag. Wahrscheinlich war es eine Mischung von beidem.
Wir wussten schon vor der Geburt meines zweiten Kindes, dass etwas nicht in Ordnung ist, aber nicht was. Das war eine wahnsinnige Last, die ich bis zur Geburt trug. Im Leben hast du vieles in der Hand, aber eben nicht alles. Du hoffst einfach, dass das, was du nicht in der Hand hast, dir gut gesinnt ist.
Meine Tochter kam abrupt und unschön auf die Welt, ich sah sie an und fand sie perfekt. Dann kam eine Hiobsbotschaft nach der anderen, motorische und kognitive Beeinträchtigung, wegen einer vorgeburtlichen Virusinfektion. Irgendwelche Ärzte sagen das in mitleidigem Ton. Aber du begreifst das nicht. Ich sah meine Tochter im Brutkasten, konnte sie in den Arm nehmen und nichts mit diesen Aussagen anfangen.
Die Gesellschaft macht all diese Schubladen, zu dick oder zu dünn, zu klein oder zu gross, behindert oder nicht behindert. Und die Ärzte sagen, diese oder jene Hirnstruktur ist nicht vorhanden, der Fachspezialist sagt, dieses und jenes geht nicht, passt nicht. Was machst du damit? Was heisst normal oder nicht normal? Das ist ein kleines Mädchen, das aus deinem Fleisch und Blut stammt und das du liebst. Es ist ein wenig anders, aber für unsere Augen ist es einfach unser Herzenskind und normal.
Die Pflege unserer Tochter ist mit brutal viel Aufwand verbunden. Das muss man nicht schmälern, es ist lebensfüllend. Eine Zeit lang wollte ich nicht mehr zu den Terminen, weil ich mich vor dem fürchtete, was schon wieder nicht in Ordnung ist. Es gab Zeiten, da war es so schwierig, da stellte ich mir die Frage, wie es wäre, wenn sie nicht mehr da wäre. Plötzlich war meine Tochter wegen einer starken Erkrankung mit kritischem Zustand im Spital und ich realisierte, das wäre die Hölle, wenn sie nicht mehr bei uns wäre. Es war unglaublich schön, erleichternd und erfüllend dies zu spüren. Unsere Tochter ist ein Teil von uns und unserem Lebensglück geworden.
Während Corona fielen alle Therapien meiner Tochter aus, ich hatte mega Schiss, dass diese Lücke ihre Entwicklung bremst. Und was ist passiert? Genau das Gegenteil, sie hat Gas gegeben. Vielleicht hatte sie vorher teilweise gar nie die Zeit, sich zu entfalten. Jetzt wird es immer spannender, mit zweieinhalb Jahren beginnt sie Charakter zu zeigen, ihren eigenen Willen. Sie hat es faustdick hinter den Ohren, macht Blödsinn, legt dich rein. Wenn sie nicht bekommt, was sie will, dann motzt sie. Sachen, die dich bei anderen Kindern vielleicht nerven würden, sind bei ihr toll, weil es fast ein Wunder ist, dass sie das tut. Ihre Stärke ist kommunizieren, aber noch ohne Worte, dafür mit einer umso ausgeprägteren Mimik. Und sie strahlt meistens, ist so zufrieden, wahnsinnig herzig, eine richtige Ulknudel, die alle Mitmenschen zum Lachen bringt. Sie ist ein Sonnenkind.
Das, was nicht gut ist, kennen wir ja. Das sind Fakten und die legst du irgendwann auf die Seite oder versuchst es gar nicht erst in den Vordergrund zu rücken. Und du hältst dich an dem, was sie dir zeigt, an den Fortschritten, die sie macht, an den Glücksmomenten. Ich wünsche mir das als Lebensweg, als Familienrezept, eine solche Glückseligkeit zu erreichen. Das ist ein Prozess, dem bin ich mir bewusst. Ich meinte häufig, jetzt kann ich nicht mehr, aber die Grenzen sich immer wieder neu verschoben. Man merkt, zu was ein Mensch alles fähig ist, wie belastbar du wirklich sein kannst.
Ich möchte mir nicht auf die Schulter klopfen, aber ich finde, ich habe es im Griff. Ich verstehe, was ich selbst als Mensch brauche, ich gebe mich nicht her, kremple nicht mein komplettes Leben um. Klar habe ich Zukunftsängste. Meine Tochter ist abhängig von uns und wird es auch in Zukunft sein, aber schlussendlich ist sie ein Individuum und ich bin ein Individuum.
Ich bin ein Typ, der Millionen Sachen in den Tag reinpacken kann, habe grosse Ansprüche an mich selbst: ich will gute Mutter sein, auch für meinen grösseren Sohn, den ganzen Haushalt schmeissen, eine gute Partnerin und eine super Arbeitnehmerin sein, nebenbei noch ein paar Hobbys und einen grossen Freundeskreis pflegen; ein Sibesiech. Meine Tochter ist dabei die beste Lebensschule: sie hat mir bewiesen und mich gelehrt, dass das so gar nicht geht. Sie hat mich gelehrt runterzufahren, den Perfektionismus und die ewige Hilfsbereitschaft dem ganzen Umfeld gegenüber etwas auf die Seite zu legen und Zeit für mich zu investieren. Ohne sie würde ich mir zum Beispiel den Freitag nicht für mich selber freinehmen. Weil ohne einen offiziellen Grund braucht es das ja vermeintlich nicht. Entweder man arbeitet oder betreut die Kinder mit Haushalt.
Als meine Tochter drei Monate auf der Welt war, sagte mir jemand etwas sehr Schönes: Glück definiert sich nicht daran, was dir das Leben gibt. Ihr habt jetzt eine grosse Herausforderung, aber es kann gut sein, dass ihr euch nun viel mehr auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben besinnt. Auf Grundwerte, Liebe, die Basis, vielleicht erlebt ihr das viel inniger und intensiver. Es kann gut sein, dass ihr eine viel glücklichere Familie sein könnt als eine Familie, die kerngesund ist. Das hat mich damals wahnsinnig beeindruckt und aufgewühlt, aber jetzt, nach zweieinhalb Jahren, beginne ich es wirklich zu verstehen.
Bei uns leben Leonie, Michèle und ihre Tochter Tiffy, Mimi, Bo, Kona und der kleine Tim. Viele berührt die Geschichte von Leonie ganz besonders. Als sechswöchiges Schweinchen rettete sie sich mit einem Sprung vom Transporter zu uns auf den Hof Narr. Seither gewinnt sie mein und das Herz unserer Besucher mit ihrer verschmusten und freundlichen Art jeden Tag aufs Neue.
Wenn ich hierhin komme, fühlen die Schweine meine Stimmung sofort und reagieren sehr darauf. Bin ich gestresst oder traurig, denken sie sich etwas aus, um mich zu entspannen oder aufzuheitern. Habe ich aber zu schlechte Laune, lassen sie sich davon anstecken und sind ebenfalls schlecht drauf. Wie alle Tiere durchleben sie Freude, Liebe und Angst. Schweine sind nicht nur clever und von Natur aus stubenrein, sondern lernen auch besonders schnell und knüpfen Beziehungen früher als Haustiere wie zum Beispiel Hunde. So ist es völlig paradox, dass wir Hunde bei uns halten und hätscheln, während Schweinen nichts anderes übrigbleibt als zusammengepfercht in dunklen Ställen darauf zu warten, dass sie geschlachtet werden.
Im Philosophiestudium haben wir diskutiert, wie eine gerechtere Welt aussehen könnte, wie wir gemeinsam leben wollen. Dann kam ich aus dem Studium raus und merkte, dass zwar theoretisch, im Kopf, alles da wäre, aber kaum etwas davon umgesetzt oder angewandt wird. Ich wusste, dass ich nicht nur denken und über eine gute Welt sprechen will, sondern etwas machen. Kein Konzept erstellen, einfach loslegen, einfach mal anfangen, das Gegenteil des wissenschaftlichen Ansatzes halt.
Unser Ort muss einer sein, wo wir ausprobieren, machen und lernen. Eine kleine, in sich funktionierende Welt, die auch im Grossen umgesetzt werden könnte. Viele der Probleme unserer Gesellschaft stehen im Zusammenhang mit unserem Verständnis und Umgang mit Tieren, deshalb war für meinen Mann und mich schnell klar, dass Tiere zu unserem Ort gehören werden. Welche, das hat sich von selbst ergeben.
So wohnen bei uns unterdessen neben den Schweinchen auch Hühner, Truten, Kaninchen, Pferde, Katzen, Ziegen und Hunde. Sie alle haben ihre ganz eigene Geschichte – wurden wie Leonie vor dem Schlachter gerettet oder hatten bei ihren früheren Besitzern einfach keinen Platz mehr. Das Telefon klingelt oft: hast du noch Platz für eine Ziege? Natürlich können wir nicht alle Tiere aufnehmen, aber es beruhigt mich, dass sich unterdessen fast immer ein Plätzchen finden lässt, denn unser Konzept wächst und allein in diesem Jahr sind einige neue Lebenshöfe um uns herum entstanden. Die Tiere bleiben, sie haben ja auch eine Aufgabe als Botschafter und Lehrer, stellvertretend für ihre Artgenossen, die nicht so viel Glück hatten. Sie ermöglichen vielen unserer Besucher einen ersten Kontakt mit sogenannten Nutztieren. Es ist schon erstaunlich, dass in der Schweiz fast 2 Millionen Schweine leben, viele Menschen aber noch nie wirklich eines zu Gesicht bekommen haben, geschweige denn miterlebt haben, wie sozial diese Tiere sind, welche unterschiedlichsten Charakter sie haben, wie sie uns zeigen, dass sie gesund und glücklich sind.
Als wir hier angefangen haben, war man im Dorf skeptisch, die Gerüchteküche hat gebrodelt. Eine Frau, frisch von der Uni, erst noch Philosophin, und jetzt Landwirtin? Wir wollten uns vorstellen, von unseren Ideen erzählen, deshalb haben wir alle zu uns auf den Hof eingeladen. Gekommen sind vielleicht fünf. Aber das spielte gar keine Rolle, es war einfach wichtig, dass wir von Anfang an offen auf die Leute zugingen. Als bei einem Sturm unser Gemüsetunnel kaputt ging, war klar, für den Wiederaufbau bräuchten wir einen anderen Platz. Nach einigem hin und her haben wir dann bei unserem Nachbarn gefragt, ob wir ein Stück direkt vor dem Hof pachten könnten. Er fragte darauf nur: Wie viel braucht ihr? Dass er das einfach so gemacht hat, hat im Dorf zuerst für einige Verwunderung und weitere Gerüchte gesorgt. Er hingegen gab uns damit die schönste Bestätigung für unser Wirken. Ganz allgemein bekommen wir viel Zuspruch aus dem Dorf, das motiviert uns weiter so zu machen. Es kommen auch immer mehr Landwirte zu uns und wollen sehen, wie wir unseren Hof führen und wie sie in eine ähnliche Richtung gehen können.
Der Hof Narr ist ein Lebenshof, etwas chaotisch, man merkt, es lebt. Es kommen so viele Menschen vorbei, kleine Kinder, grosse Kinder, Grosseltern, Flüchtlinge vom benachbarten Durchgangsheim… jeden Tag kommen andere Leute und viele kehren immer wieder zurück. Man merkt, es gibt ganz viele Menschen, die nur darauf warten, etwas für die Welt machen zu können.
Und das hier, das ist Sir Kevin, unser Truthahnmännchen. Er ist ein ganz Verschmuster und mag die Aufmerksamkeit sehr, auch wenn er am Anfang etwas scheu ist. Kevin wäre beinahe zusammen mit einigen Gänsen beim Schlachter gelandet, doch er hatte Glück und wurde von lieben Menschen aufgenommen, bis er ein Plätzchen bei uns fand. Nach anfänglicher Zurückhaltung zeigt er unterdessen gerne seine Federn und stolziert auf dem Hof umher, um seine beiden Damen Hailey und Mathilda und uns zu beeindrucken.
Geschichte Nr. 2 aus unserer Reise ins El-Comedor-Universum. Geschichte Nr. 1 über den Hintergrund von Comedor könnt ihr hier lesen.
Vor rund zweieinhalb Jahren zog ein neues Pärchen in unserem Mehrfamilienhaus ein und mit den beiden kam auch das Projekt El Comedor zu uns. Unterdessen machen vier der fünf Parteien mit und ehemalige Hausbewohner, die nicht allzu weit weggezogen sind, sind weiterhin Teil der Bestellgemeinschaft.
Alle drei Monate gibt es eine Bestellrunde, bei der wir zusammen Lebensmittel und Dinge für den Alltag aussuchen und bestellen. Dazu treffen wir uns immer abwechselnd in einer anderen Wohnung. Das letzte Mal waren wir bei uns. Zuerst gibt es immer etwas zu essen, zu trinken und den neusten Quartierklatsch, bevor wir dann zusammen die Bestellliste durchgehen. Da einige der Waren nur in grossen Einheiten geliefert werden, wie Mehl zum Beispiel, macht es Sinn, sich abzusprechen, gemeinsam zu bestellen und sich zu koordinieren. Und natürlich sehen wir uns auch einfach gerne. Beim Treffen können wir uns gegenseitig über Produkte austauschen und Ratschläge geben – so haben wir neben Mehl, Hülsenfrüchten, Pelati, Kokosmilch und Kosmetika oder Putzmittel auch schon Saubohnen und Buchweizenkörner ausprobiert. Das hätten wir sonst wohl nie getan.
Etwa drei Wochen nach der Bestellung findet die Auslieferung statt. Von der grossen Verteilzentrale werden alle Produkte unserer Gruppe in den Gang vor unserer Wohnung geliefert. Noch am gleichen Tag teilen wir grosse Einheiten in kleinere auf und sortieren die Produkte für die einzelnen Haushalte. Dazu brauchen wir Waagen und jede Menge helfender Hände. Ist alles verteilt, wird gesaugt. Dies ist immer unsere Aufgabe, weil wir im Parterre wohnen und unser Sauger der nächste ist.
Vor Comedor war ich kein Vorratstyp, ich musste häufig nach der Arbeit in den Laden und zwischen den anderen gestressten Leuten einkaufen, das hat mich immer genervt. Das hat sich jetzt stark geändert. Was haltbar ist, kaufen wir bei Comedor ein und für frische Produkte geht mein Freund am Freitag jeweils auf den Markt. Brot backe ich fast immer selber und wenn ich mal eines kaufen muss, ist es einfach weniger fein. So gehe ich alles in allem wirklich nur noch selten in Supermärkten einkaufen, für mich ein schöner Gewinn an Zeit und Lebensqualität. Durch die Zusammenarbeit und die gemeinsamen Bestellanlässe haben sich auch die Beziehungen zwischen uns Nachbarinnen auf schöne Weise verändert. Wir teilen und helfen uns jetzt auch in anderen Bereichen viel häufiger. Wenn sie fertig mit Lesen ist, bringt mir jetzt meine Nachbarin zum Beispiel ihren «New Yorker». Dafür beteilige ich mich an den Kosten.
Ich esse unglaublich gern und ich habe einen starken Bezug zu Lebensmitteln. Was braucht es, damit etwas wächst, gedeiht, verpackt, transportiert und verkauft ist? Diesen ganzen Kreislauf bis man etwas essen kann finde ich unglaublich faszinierend.
Ich bin bei der Organisation Foodsharing verantwortlich für acht Betriebe und koordiniere da die Abholungen. Wir holen bei Restaurants, Detailhändlern, Takeouts, Märkten und Gemüseläden das Essen ab, welches sie sonst wegwerfen würden. In Zürich haben wir fast tausend Foodsaver, die bei den 47 Betrieben abholen, welche mit uns kooperieren. Natürlich sind wir einen Tropfen auf den heissen Stein. Aber ich konzentriere mich auf das, was wir retten und nicht auf das, was immer noch weggeworfen wird.
Wir wollen den Betrieben so wenig Arbeit wie möglich machen, dezent sein, die Kundschaft vorlassen, alles sauber hinterlassen, selber aussortieren. Neulinge müssen ein Quiz über die Grundsätze, Verhaltens- und Hygieneregeln und einige andere wichtige Themen absolvieren. Danach werden sie für die ersten drei Abholungen von erfahrenen Foodsavern begleitet und eingeführt, sodass wir die neuen Gesichter kennen lernen können. Damit die Abholungen mit so vielen und auch sehr grossen Betrieben funktionieren, braucht es Regelungen. Die jeweiligen Betriebe sind sehr glücklich, dass wir kommen und sie somit keinen Foodwaste produzieren.
Ich und mein Zuhause sind ein Umschlagplatz für gerettetes Essen geworden. Ich habe einen Broadcast, wo ich schreibe, was es bei uns gerade abzuholen gibt. Unser Zuhause ist somit eine Bring- und Holstation. Immer öfters bringen mir Foodsaver-Freunde etwas von ihren Abholungen und nehmen von uns etwas mit. Es entstehen tolle Tauschaktionen. Wir haben oft so viele Lebensmittel im Haus, dass wir schauen müssen, dass sie nicht schlecht werden. Immer wenn ich jemanden besuche, habe ich auch Essen dabei. Was ich schon an Essen von A nach B gebracht habe, ist absurd.
Es brennt mir schon unter den Nägeln und manchmal fühle ich mich machtlos, aber dann sage ich wieder: ich kann sehr viel machen. Ich habe so viele Entscheidungen zu treffen, jeden Tag. Ich möchte das Gute sehen, die Schönheit, und dies mit Bekannt und Unbekannt teilen. Es passiert jetzt auch wirklich so viel Gutes und Wertvolles auf unserem ganzen Planeten. Es sollte eine Zeitung geben, die nur solche guten Geschichten niederschreibt.
Meine Familie lebt im Überfluss, das sagen wir uns regelmässig. Gleichzeitig hat unsere Lebensart auch etwas sehr Bescheidenes. Manchmal habe ich Lust auf etwas Bestimmtes, zum Beispiel Pizza. Doch dann koche ich doch meistens das, was ich im Kühlschrank finde und was unbedingt gegessen werden sollte. Das ist ein Perspektivenwechsel. Es hat damit zu tun, einen bestimmten Gedanken oder Essenswunsch loszulassen. Wenn ich keine genaue Erwartung habe, dann kann ich immer wieder beschenkt werden. Ich liebe Improvisation, nicht nach Rezept zu kochen, spontan zu entscheiden. Ich esse definitiv vielseitiger als wenn ich einkaufen gehen würde. Mit Resten kann ich jonglieren und kreieren. Wenn man das so sieht, dann leben wir wirklich im Überfluss.
Ich bin in der Altstadt aufgewachsen. Hier gab es alles, was man zum Leben brauchte. Heute hast du fast nur noch Kleider- und Cremli-Läden. Es hat alles, was man nicht braucht. Und es ist abends sehr laut von den Leuten im Ausgang. Während des Lockdown war es so ruhig wie nie zuvor, man konnte mit offenem Fenster schlafen und hörte viele Vogelstimmen. Jetzt ist das aber schon wieder vorbei. Rundherum hat sich so vieles extrem verändert, aber der Schluuch ist eine Oase der Ruhe in dieser Hektik geblieben. Wegen Corana dürfen wir nicht alle Plätze im Restaurant besetzen, darum sitzen jetzt bei uns Plüschtiere am Tisch.
Mein Vater hat das Kafi Schluuch 1923 gegründet, ja, mein Vater, nicht mein Grossvater. Er war Jahrgang 1889 und kam nach dem ersten Weltkrieg aus Österreich. Meine Mama kam nach dem zweiten Weltkrieg in die Schweiz. Ich wurde 1960 geboren, als mein Vater 72 Jahre war. Als ich fünf war, starb er. Ich bin also ohne Vater aufgewachsen, aber mit drei Müttern: meiner Mutter und den beiden deutlich älteren Halbschwestern. Ich hatte auch zwei richtige Schwestern, wir waren ein echtes Frauenhaus. Nach dem Tod des Vaters hat eine Halbschwester den Betrieb geführt. Meine Mama war weiterhin in der Küche. Sie hat hervorragend gutbürgerlich gekocht.
Mein Mann und ich kamen über Umwege in den Schluuch. Ursprünglich wollte ich wirklich nicht hier festsitzen, sondern die Welt sehen. Ich arbeitete als Ernährungsberaterin, mein Mann war eigentlich Maschinenbautechniker, aber als Ausländer bekam er in seiner Branche keine Stelle. Er arbeitete als Hausmann und hat dann im Schluuch ausgeholfen. Das Kellnern gefiel ihm gut, weil er gerne mit Menschen zu tun hat. Als meine Halbschwester und meine Mutter so langsam nicht mehr wollten, haben wir gesagt: Dann übernehmen wir das, aber richtig und zusammen. Wir dachten zuerst, wir machen jetzt alles anders und besser. Aber dann merkst du, dass vieles eigentlich ganz gut war, so wie es war. Wir haben darum wenig verändert, einfach die schweren Vorhänge rausgenommen, das Oberlicht und die Seitenfenster umgestaltet, so dass alles heller wurde. In der Küche wollte ich nicht einfach im gleichen Stil weitermachen. Ich hatte mich schon länger mit Anthroposophie beschäftigt und habe dann diese Philosophie in der Küche eingeführt. Später kam ein Koch aus Sri Lanka und mit ihm die ayurvedische Küche. Beide Ideen sind sich darin ähnlich, dass sie den Menschen als Ganzes sehen. Das passt auch sonst zu unserer Idee vom Schluuch.
Der Schluuch ist so wie es uns passt, er ist authentisch und echt. In der Küche brauche ich keine Sterne, ich habe sie am Himmel. Wir sind ein Familienbetrieb. Wer hier arbeitet oder Stammgast ist, gehört auch zur Familie. Im Haus wohnen Mieterinnen und Mieter, Familienmitglieder und auch Mr. Singh, unser indischer Küchenhelfer, der seit Jahren mit Begeisterung den Garten bestellt. Während Corona musste sich niemand Sorgen wegen der Miete machen. Und jemand hat sogar die Kosten für die Auffrischung des Gastraums übernommen. Man könnte aus dem Betrieb und dem Haus sicher mehr Profit machen. Unsere Banker sagen immer wieder: Mit Gutmenschen wirtschaften ist nicht profitabel. Aber wir zahlen unsere Zinsen rechtzeitig und darum geht es die gar nichts an. Wenn man weniger auf den Gewinn achtet, gewinnt man viel.
Einer meiner Neffen ist Koch und hat die Hotelfachschule gemacht. Wir haben schon darüber gesprochen, ob er vielleicht den Schluuch übernehmen würde. Mein Mann ist 63 und ich 60, also machen wir uns schon Gedanken über die Nachfolge. Der Neffe sagt, wieso nicht, aber dann würde er alles anders machen. Man muss dann loslassen können. Noch ist es nicht soweit.
Ich habe vor drei Jahren zum ersten Mal die Trendsportart «Sign spinning“ gesehen. Leute hatten den Job, an der Strasse zu stehen und Werbeschilder hoch zu halten. Aus Langeweile und zur höheren Werbewirkung fingen einige von ihnen an, diese Schilder zu manipulieren, herumzuwirbeln, hoch in die Luft zu werfen, sich darunter im Kopfstand zu drehen und so weiter.
Um ehrlich zu sein habe ich mich zuerst gekrümmt vor Lachen. Dann fand ich diese Verbindung von Sport, Zirkusdisziplin und Werbung äusserst zeittypisch. Ich sah darin ein unglaubliches Potential. Wie wäre es, wenn wir auch Strassenwischen, Laubrechen, Schnee schieben, Wiese mähen etcetera zu Trendsportarten erklären und auch so vermitteln. Man kann gerade zum Beispiel mit einem Besen unglaubliche Figuren machen und gleichzeitig die Strasse säubern.
Tatsächlich war es nur ein kleiner Schritt, ein Umlegen des Empfindungsreglers, und siehe da, mein Schneeschaufeln bei Sonnenschein mit der Körperaufmerksamkeit einer Taichi Übung war mindestens so aufregend und abwechslungsreich wie Skifahren.
Für mich wäre ein voller virtueller Präsenzunterricht während dem Lockdown der totale Stress gewesen. Das wäre wie Schule ohne Schule machen. Man sieht sich in jeder Lektion, die im Stundenplan steht, und am Schluss gibt es Noten. Es wäre ein grosser Eingriff in die Privatsphäre, in die der Schülerinnen und auch in meine. Man müsste immer etwas zurechtmachen, den Raum, sich selber. Und es ist ja auch unwahrscheinlich, dass jedes Kind in der Familie daheim einen ruhigen Platz und einen Computer mit Kamera hat, und dass es jederzeit ungestört reden und zuhören kann.
Unsere Schulleitung hat es sehr gut gemacht. Es wurde gesagt: Ihr müsst zuerst runter- und dann langsam in angepasster Weise wieder rauffahren. Ich gebe Geschichte bei sieben Klassen mit etwa 200 Schülerinnen, auf drei Stufen. Ich habe jede Woche Aufgaben verteilt und war zu bestimmten Zeiten verfügbar für Fragen oder ein Gespräch. So hat es eigentlich ganz gut geklappt. Ich habe in Gruppen von vier bis fünf Leuten arbeiten lassen. Ich liess Freunde zusammenarbeiten. Das ist vielleicht etwas weniger effizient, weil sie sich dann, statt sich mit der Aufgabe auseinanderzusetzen und brillante Lösungen zu erarbeiten, über ihren Alltag unterhielten. Aber ich wollte eben nicht noch mehr Stress machen. Es war mir wichtiger, dass es ihnen so gut geht wie möglich.
Den wöchentlichen Auftrag bekamen die Schülerinnen in einem Format, das ich schon vor Corona entwickelt hatte. Es gibt eine Quellenbild und dann ungefähr zwei Seiten Text dazu. In der Corona-Zeit habe ich das ergänzt mit einer zusätzlichen Seite, wo ich die Schülerinnen direkt anspreche. Darauf ist ein gezeichnetes Portrait von mir selbst und eine handschriftliche Botschaft, wo ich etwas erkläre oder sie auch frage, wie es ihnen geht. Sie sollen mich als Person wahrnehmen und merken, dass ich mich um sie kümmere. Meine persönliche Seite war zuerst skizzenhaft, ein Strichmännli, später hat es dann einen inhaltlichen Bezug gegeben. Beim Blatt über die Christianisierung der Römer hat mein gezeichnetes Ich den römischen Legionsadler weggekickt und dafür das Zeichen der Christen in der Hand gehalten. Noch später habe ich mich in die Szene hineingemalt, ich war ein Germane auf der Völkerwanderung, wir wurden von den Hunnen angegriffen. Und dann habe ich die Quellenbilder in einem Video erklärt, wo ich den Kontext zeigte, wo hängt das Bild, wie gross ist es, und auf Details gezoomt, über die ich geredet habe.
Ich habe mir Mühe gegeben, alles schön zu gestalten und fand es selber ganz toll. Ich dachte, sie geben sich vielleicht dann auch Mühe bei ihrer Arbeit. Zuerst war ich etwas enttäuscht, dass sich niemand dafür bedankte. Aber dann merkte ich: Das ist ja nicht, was Schülerinnen machen. Sie kommen ja im Präsenzunterricht auch nicht und bedanken sich, schon gar nicht in der Gruppe. Warum sollten sie extra ein Mail schreiben? Und ich merkte, dass ich es eigentlich für mich mache, weil es mir Spass macht, weil ich gerne so unterrichte. Manchmal, wenn ich allein mit einem Schüler im Call war, kam dann tatsächlich auch noch ein Dankeschön.
Ich habe in der Lockdown-Zeit eine einzige Einzelaufgabe gestellt. Man hört ja oft «Wir erleben gerade Geschichte.» Also bat ich die Schülerinnen um eine Quelle. Was denkt ihr über diese Zeit, wie erlebt ihr sie? Es kamen Texte und Lieder, ein gehäkeltes Virus, verzierte Masken, aber auch ein berührender Brief einer Schülerin an ihren Grossvater im Spital, der vielleicht sterben würde, den man aber nicht besuchen konnte. Ich weiss nicht, was ich mit diesen Zeugnissen des Lockdown machen werde. Vielleicht nutze ich das eine oder andere aus dieser besonderen Sammlung in einem Jahr im Unterricht. Aber wer weiss, wie die Welt dann aussieht.
Ich wurde vor einem Jahr in den Regierungsrat gewählt. Ich stehe nun an der Spitze einer Organisation mit rund 1800 Mitarbeitenden, die ziemlich hierarchisch aufgebaut ist. Eine ordentliche Veränderung für mich, arbeitete ich bis dahin in einer Firma mit fünfzehn Personen. Lange vorbereiten konnte ich mich nicht auf diesen Wechsel. Es blieben sechs Wochen zwischen Wahl und Amtsantritt. Während dieser Zeit schrieb ich meine Dissertation fertig – ein bisschen Zeitdruck ist manchmal hilfreich.
Ich hatte grosses Glück, dass mein Vorgänger eine Direktion hinterliess mit guten Leuten und einer guten Kultur. Man hört einander zu und sagt offen, wenn einem etwas nicht passt. Das finde ich sehr gut. Trotzdem gab es mit mir offenbar auch einige Veränderungen, die mir zuerst gar nicht bewusst waren. Beispielsweise bot ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Du an bei der ersten Begegnung. Das war neu. Oder später wurde mir erzählt, dass bis zu diesem Tag es sehr üblich war, Krawatten zu tragen. Das fiel mir nicht auf. Denn da ich keine trug, haben sich alle sehr schnell dem neuen Standard angepasst.
Das sind die einfachen Veränderungen in einer Organisation. Ich will aber weiter. Ich bin der Ansicht, dass die Zeiten der klaren Hierarchien vorbei sind. Wenn es gelingt den Stellenwert von Hierarchie in einer Organisation zu verringern, wird sie ungleich leistungsfähiger. Denn dann kann die Verantwortung und die Arbeit besser verteilt werden. Vor einiger Zeit habe ich unbemerkt eine Grenze überschritten: Bei einem Geschäft mussten wir in einer parlamentarischen Kommission unser Projekt vertreten. Ich wollte, dass mich statt dem Amtschef die zuständige Projektleiterin begleitet. Die versteht inhaltlich ja am meisten von der Frage. Da hiess es: das geht nicht, es braucht den Amtschef, das haben wir immer so gemacht. Die Parlamentarierinnen könnten es ja als respektlos empfinden, wenn nicht die Chefs kommen. Ich habe gesagt: Wenn es nicht funktioniert, machen wir es beim nächsten Mal wieder anders. Und man muss es auch einfach ein bisschen locker nehmen. Die Kommission hatte dann tatsächlich kein Problem damit, dass nicht der Amtschef aufgetaucht ist. Das Geschäft ist gut durchgekommen und der Amtschef und ich sind beide mit dem Vorgehen zufrieden.
Wir haben auch in der Corona-Zeit viel gelernt. Von einem Tag auf den anderen arbeiteten bei uns grosse Teile der Belegschaft von zuhause aus. Und das hat alles deutlich besser funktioniert als gedacht. Die Leute sind bereit Verantwortung zu übernehmen, wenn sie sie denn bekommen. Doch viele Chefs fürchten in solchen Situationen die Kontrolle zu verlieren. Deshalb waren die wohl auch der Ansicht, dass Homeoffice nicht funktionieren würde. Das Experiment «Corona» hat das Gegenteil bewiesen. Wer glaubt die Kontrolle zu haben, unterliegt so oder so einer Illusion. Denn die Zeit ist vorbei in der ein Chef einen Plan ausdenken kann, der dann so umgesetzt wird. Die heutige Welt ist dafür zu komplex. Es braucht sehr viel Austausch über die Grenzen von Abteilungen hinaus und den Mut etwas auszuprobieren. Wenn es dann schief geht, muss nicht der Schuldige gesucht werden, sondern man probiert einen anderen Ansatz.
Ich glaube, dass Gruppen gute Lösungen finden, wenn sie divers zusammengesetzt sind. Denn dann kommen viele unterschiedliche Sichtweisen zusammen, was für die Lösung von komplexen Problemen von Vorteil ist. Ich bin beispielsweise sehr froh, dass mein Generalsekretär schon seit mehr als 20 Jahren in der Organisation arbeitet und sehr grosse Erfahrung mitbringt. Das ist eine optimale Kombination. Ich bringe viele neue Ideen und Ansätze für Veränderung und er zeigt die Risiken auf oder was in Vergangenheit funktioniert oder eben nicht funktioniert hat. Ich erlebe diese Zusammenarbeit als sehr fruchtbar.
Neben meinen politischen Zielen ist es mir wichtig, dass sich die Direktion weiter entwickelt zu einer Organisation, die Lösungen findet, die für alle akzeptabel sind, die gute Leistungen anbietet für die Bevölkerung, die aktiv den Kanton gestaltet und in der die Leute gerne arbeiten.
Ich bin jedes Jahr ein paar Wochen als Hüttenwart auf einer Alp. Ich koche, putze, flicke und erledige alles, was sonst anfällt. Bezahlt werde ich nicht dafür. An Wochenenden ist es wirklich streng, man arbeitet von morgen früh bis abends spät. Unter der Woche oder wenn es regnet hat man mehr Zeit. Es kommen ganz unterschiedliche Leute vorbei. Ein Mann, der auf einer siebentägigen Hüttentour die Trennung von seiner Freundin verarbeitet, ein Sohn, der mit seinem 80-jährigen Vater eine Reise macht. Oder Gruppen, die ein Bier nach dem anderen trinken.
Als ich 64 wurde, habe ich gesagt, ich mag nicht mehr so viel schuften im Büro und ich habe die Arbeit Stück für Stück übergeben. Einmal übernachtete ich mit einem Freund in einer Berghütte. Es gab schrecklich verkochte Hörnli und nicht recht gebrätelte Cervelat. Da haben wir uns gesagt: das können wir besser, irgendwann machen wir das selbst.
Ich gehe fast immer zusammen mit jemandem aus der Familie oder mit Freunden. Man lernt Leute von einer anderen Seite kennen, wenn man so intensiv zusammenarbeitet, gerade auch gute Freunde und Familienmitglieder. Im Alltag findet man dafür einfach nicht die Zeit. Einmal war ich mit meinem Zwillingsbruder dort, den ich vorher lange nicht mehr gesehen hatte. Es war schön, aber nicht einfach, wie ein Spiegelbild. Ich sah, wie uralt ich selbst geworden bin, als ich gemerkt habe, wie langsam er ist. Man fühlt sich ja immer jung. Mit meinem Sohn war auch mal fünf Tage da, er war da 36. Da habe ich gestaunt, wie beweglich und flexibel er ist.
Dieses Jahr ist wegen Corona etwas schwieriger. Viele Freiwillige sind eben Pensionierte. Es ist unklar, wie man mit der Risikogruppe umgeht. Alte sind ja nicht ansteckender, nur das Risiko einer schweren Erkrankung ist höher. Aber das verwechseln die Leute manchmal und es hat lustige Auswirkungen. Wenn sie mir im Töbeli entgegenkommen und einen Riesenbogen machen, fast in den Bach stürzen, weil da ein besonders ansteckender Alter kommt.
Ist die Zeit auf der Alp für mich nun Ferien oder Arbeit? Irgendetwas dazwischen.
Ich komme aus Indien und arbeite seit 23 Jahren als Küchenhilfe im Café Schluuch. Jeden Tag um zwei Uhr bin ich fertig mit der Arbeit. Ich habe auch eine Wohnung oben im Haus. Meine Chefin ist Gabi, die weiss alles über das Haus und das Café.
Vor etwa fünf Jahren habe ich angefangen, auf der Mauer beim hinteren Eingang einen langen, schmalen Garten anzulegen. Ich habe ein Gerüst für die Tomaten gebaut, und oben beim Eingang den Zaun erhöht, dort sind vorher immer die Kinder reingeklettert. Abgebrochene Billardstöcke sind ganz praktisch, siehst du den da?
Ich habe viele Tomaten, Kürbisse und Gurken, dazu Bohnen, ein Blumenkohl und viele verschiedene Blumen. Es war dann aber doch zu wenig Platz, und so habe ich vor drei Jahren angefangen auf dem Dach der Billard-Halle Beete anzulegen und grosse Plastikkübel aus der Küche und Blumentöpfe zu bepflanzen. Dort oben habe ich ganz viele Chili-Pflanzen, mehr Tomaten, Gurken und Kürbisse. Und darauf bin ich besonders stolz: Ladies’ fingers, die ich ich aus Samen gezogen habe. Letztes Jahr habe ich das zum ersten Mal gemacht, und da hatten wir ziemlich Ertrag. Siehst du dort den Balkon: Das ist meiner und dort habe ich noch mehr Tomaten. Vielleicht muss ich nächstes Jahr noch mehr Beete hier auf dem Dach anlegen.
Die Ernte wird im Restaurant verwendet oder wir essen an unseren Freitagen davon. Der Rest wird mit Nachbarn getauscht und manchmal an die Mitarbeiter oder Gäste verschenkt. Zeigst du das Foto dann meiner Chefin und auch den Kolleginnen im Café?
Jede Woche liefert Grassrooted 500 Päckchen gerettetes Biogemüse an unsere Abonentïnnen. Bei den Mengen an Gemüse, die in der Schweiz schon auf dem Bauernhof weggeworfen werden, ist das natürlich nicht so viel, aber es ist ein Anfang und es bringt das Thema vielleicht mehr ins Bewusstsein. Unser Service war durch Corona eigentlich nicht stark betroffen, Essen hat ja nicht aufgehört.
Aber dann haben wir von den grossen Online-Lieferdiensten gehört, die teilweise monatelange Lieferfristen hatten, weil die Logistik überfordert war. Wir haben uns gedacht, wir sind ja an der Quelle, wir kennen die Lebensmittelproduzentïnnen, haben die Kontakte. Vielleicht können wir die Leute unterstützen, die in der Risikogruppe sind, und gleichzeitig auch lokale Produzentïnnen. Damit nicht alle zum Detailhändler rennen müssen. Zu fünft haben wir das in wenigen Tagen auf die Beine gestellt. Unsere Idee war, Lebensmittel und Produkte für den täglichen Bedarf bereitzustellen, eine Art Grundversorgung. Wir haben das Telefon in die Hand genommen, Lieferantïnnen und Produzentïnnen kontaktiert und eine Sortimentsliste mit 30-40 Produkten erstellt. Diese konnte man via E-Mail ausfüllen und wir haben zweimal pro Woche per Velokurier geliefert. Von der Idee bis zur Umsetzung hat das vielleicht eine Woche gedauert. Anfangs gab es noch die Überlegung, Produzentïnnen zu helfen, die jetzt nicht mehr an lokalen Märkten verkaufen konnten. Aber die haben sich sehr gut selbst organisiert, manchen wurde sogar die Bude eingerannt, weil die Leute mehr regionale Lebensmittel wünschten.
Sehr viele Leute hatten Lust, als Velokuriere auszuhelfen, Freunde, deren Pläne durch Corona eh über den Haufen geworfen wurden. Wir bekamen aber auch E-Mails von Leuten, die wir überhaupt nicht kannten, die mithelfen wollten. Es war schwieriger, die Leute zu erreichen, die Hilfe brauchten, als Helferïnnen zu finden. Wir hatten viele Leute, die sehr dankbar waren. Leute in der Pflege, die nicht mehr am Abend einkaufen gehen mussten. Oder ein älteres Ehepaar, das sich freute, dass immer wieder Leute mit dem Velo lieferten, die sie bereits kannten. Aber auch von nicht so stark betroffenen Menschen haben wir Anfragen bekommen: «Dürfen wir auch bestellen, wenn wir nicht in der Risikogruppe sind?». Wenn man nicht so dem Konsum nachgeht, können grosse Läden eine richtige Reizüberflutung sein.
Und dann kamen plötzlich noch grosse Lebensmittelhändlerïnnen, die nicht mehr wussten wohin mit überschüssigem Essen, da “Tischlein deck dich” wegen Corona viele Ausgabestellen schliessen musste. Wir haben uns überlegt, was könnten wir damit machen, wie bringen wir es zu den Leuten, die es wirklich nötig haben? Wir liefern das Essen nun an die Autonome Schule, die die Lebensmittelausgabe “Essen für alle” organisiert, für Sans Papiers, Migrantïnnen oder Menschen am Existenzminimum, die vom Kurzarbeitslohn nicht leben können. Die waren sehr froh, sie hatten einen riesigen Ansturm.
Es war der Freitagabend, an dem beschlossen wurde, dass die Schulen zugehen. Am Samstagmorgen hatte ich eine Schicht als Mitarbeiterin an der Kasse. Ich schrieb meiner Chefin und sie meinte, ja, vielleicht kommst du besser etwas früher… Am nächsten Morgen sind die Kunden bis keine Ahnung wie weit nach hinten angestanden, mit viel zu wenig Abstand. Ich dachte mir, mein Gott Leute, bleibt doch etwas zurück, wir haben jetzt doch alle gehört, dass das gefährlich ist! Und ich regte mich schon ein bisschen über die Leute auf, die ihre Einkaufswägen bis nach oben füllten. Das waren aber eigentlich nur wenige. Der Tag war absolut crazy, so etwas habe ich noch nie erlebt. Es waren so viele Leute, es kamen alle auf einmal. Die ersten paar Wochen war es richtiges Chaos.
An einem Tag kam eine Kundin vorbei. Sie ging von Kasse zu Kasse und schenkte jeder einzelnen Mitarbeiterin eine Maske, die ihre Nachbarschaftsgruppe selbst von Hand gemacht hatte. Sie hatten vorher extra den Chef gefragt, wie viele Leute hier arbeiten, so dass auch sicher alle eine bekommen. Dazu hatte sie ein kleines Briefchen geschrieben: “Ihr seid unsere Engel! Wir haben Glück, ein so tolles Team in unserem Quartier zu haben.” Dann folgte eine ausführliche Anleitung, wie die Maske zu handhaben ist, wenn man sie waschen und wiederverwenden möchte.
Die Maske war mir etwas zu klein. Ich wollte eine Kordel kaufen, um sie ein bisschen erweitern zu können, aber die Kundin hatte leider für das Herstellen der Masken bereits alle Kordeln in unserer Filiale aufgekauft…
Wieso jäte ich gerne? Jäten mache ich nämlich fast am liebsten im Garten.
Erstens muss ich nicht viel studieren. Es gibt nicht viele Entscheidungen, ausser, was reiss ich aus und was nicht. Wenn ich etwas säe, habe ich immer Erwartungen, ich tu das mit einer Absicht im Kopf. Es ist ein Kampf, dass das Gesäte kommt, dass ich zur richtigen Zeit ernte, rüste, koche und dann essen muss. Man kann es ja nicht verderben lassen. Und ich muss kämpfen, dass es mich nicht nervt, wenn zum Beispiel die Schnecken die Rüebli fressen. Säen und Ernten kommt mit viel Verpflichtung. Beim Jäten hat man das alles nicht. Ich bin völlig entspannt, während ich hier und da etwas ausreisse.
Ich mache eigentlich selektives Jäten: hier darf ein bisschen wachsen, hier gar nichts, hier schon. Wie ich jäte, ist absolut ineffizient. Effizient ist, alles rauszunehmen und nichts wachsen zu lassen. Unkraut ist aber eben auch interessant. Manches wächst nur hier, manches nur da, und jedes Jahr kommt etwas anderes, das ist sehr vielfältig. Wenn ich etwas nicht kenne, jäte ich es nicht. Ich warte, bis es blüht, um zu entscheiden, ob ich etwas will oder nicht. Es ist extrem spannend zu schauen, was wächst, auch wenn du es dann nicht willst.
Was ist sonst noch schön am Jäten? Du hast einen ganz kleinen Ausschnitt der Welt vor dir, nur einen Quadratmeter, und du vergisst den Rest rundherum. Jäten ist eine endlose Arbeit, das ist ein schönes Gefühl. Wenn du mal geerntet hast, ist es vorbei. Jäten hört nie auf, Unkraut kommt einfach wieder, es spielt deshalb auch nicht so eine Rolle, wann du jätest. Du kannst es machen, wann und wie viel du möchtest. Du sitzt und kniest da und nimmst raus, was du nicht möchtest. Beim Jäten bist du auch nie so traurig, wenn du etwas rausnimmst, denn das kommt ja sowieso wieder.
Als Mitte März der Lockdown verkündet wurde, packte mich die Angst. Kann ich meinen Coiffeursalon behalten, den ich über Jahrzehnte aufgebaut habe? Ich hatte schon ein bisschen Geld gespart, aber das war eigentlich für nach der Pensionierung gedacht. Die erste Woche plagten mich die Sorgen und es ging mir gar nicht gut. Aber als es sich abzeichnete, dass es wohl länger dauern würde, sagte ich mir: So lange Ferien hast du noch nie gehabt, soviel Zeit für dich selber. Ändern kannst du sowieso nichts. Also freu dich doch lieber darüber! Und tatsächlich konnte ich dann die weiteren fünf Wochen des Lockdowns sehr geniessen. Ich habe viel im Haus und im Garten gemacht, endlich einmal ohne Stress und Zeitnot all die kleinen Sachen erledigt, habe mich mit meinen Katzen unterhalten und die Fenstersimse gestrichen. Ich habe regelmässig ausgedehnte Telefongespräche mit meinem Vater geführt. Und ich konnte mich trotz all der Aktivtäten hinsetzen und in Ruhe über etwas nachdenken oder meditieren. Ja, es war eine tolle Zeit.
Als der Bundesrat dann verkündete, dass die Coiffeure schon bei der ersten Lockerungsrunde öffnen dürfen, hörte man rundum begeisterte Leute. Wie toll es ist, wieder arbeiten zu können, wie glücklich und privilegiert man sich fühlt, als erste das normale Leben wieder aufzunehmen. Für mich war es fast ein bisschen ein Schock. Ich dachte: Von mir aus könnte es ewig so weitergehen. Natürlich freute ich mich, meine Kundinnen und Kunden wieder zu sehen, viele sind mir im Laufe der Zeit nahegekommen. Aber selber über meine Zeit zu verfügen, keine äusseren Verpflichtungen zu haben und keinen durchgetakteten Alltag – das würde ich sehr vermissen.
Ich habe verstanden, was es bedeutet, pensioniert zu sein und war auch ein bisschen neidisch auf die Leute, die in Rente sind und nicht mehr arbeiten müssen. Mit neidisch meine ich überhaupt nicht, dass ich es jemandem nicht gönnen würde, im Gegenteil. Aber ich hätte halt auch gerne viel Zeit.
Unterdessen sind schon ein paar Wochen vergangen. Ich habe mich noch immer nicht an die Maske gewöhnt. Es ist schlimm, dass man nur das halbe Gesicht sieht, man sieht zum Beispiel gar nicht recht, wenn jemand lächelt. Als Coiffeuse macht es die Arbeit nicht gerade leichter. Aber gerade eben hatte ich wieder ein so gutes Gespräch mit dem Kunden von vorhin, dass ich dachte: Ich bin schon sehr privilegiert, kann solche persönlichen Gespräche führen, so etwas würde normalerweise bei einem Treffen im Kaffee stattfinden. Aber ich arbeite dazu und verdiene so meinen Lebensunterhalt. Vielleicht ist es doch gut, dass der Lockdown nicht ewig dauerte.
Ich arbeite nun seit vielen Jahren als Betreuer in einem Heim für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Doch noch immer studiere ich dran rum, weshalb mir die Arbeit gefällt und was sie überhaupt ist. Wieso ist mir zum Beispiel manchmal viel wohler, wenn ich mit Leuten zusammen bin, die eine Beeinträchtigung haben? Das Wichtige sind häufig Kleinigkeiten. Flüchtige Dinge, die man wieder vergisst, die aber im Moment ganz wichtig sind. Ich erzähle ein paar Beispiele.
Mit den Bewohnern des Heims haben wir einmal Ferien in Holland gemacht. Eine Frau ging immer gerne in Kirchen. Als wir zusammen eine Kirche besichtigten, stand sie einfach da und hat alles angestaunt. Ich stand neben ihr und habe sie angestaunt oder zusammen mit ihr gestaunt. An einem anderen Tag besuchten wir ein Freilichtmuseum. Anstatt voranzugehen und die Richtung vorzugeben, bin ich einfach dort gestanden und habe gewartet: was macht ihr jetzt, wohin geht es? Und dann bin ich nachgelaufen und habe kommentiert, was man alles so sieht. Nichts war geplant, alles in ihrem Tempo und ich habe das angeschaut, was sie angeschaut haben. Das war extrem spannend.
Ich habe all diese Aktivitäten auch selbst sehr gerne gemacht; aber wenn du etwas selbst gerne machst und dann noch zusammen mit Menschen mit Beeinträchtigung, dann ist das eine Steigerung von Vergnügen, von Glück, von Interesse. Weil es überraschend ist, wie du selbst reagierst, du weisst nie, wie es im nächsten Moment rauskommt. Es geht nicht darum, eine Aufgabe zu erledigen, sondern darum, das Leben kennenzulernen.
Ich gehe ins Tanzen und ab und zu dürfen wir auch improvisieren, zu zweit oder als Gruppe. Das mach ich extrem gerne: etwas erfinden und dann darauf reagieren, was der andere tut. Dann bist du ganz lebendig, ganz konzentriert auf den Moment, auf die Bewegung, die Musik. Das ist dasselbe bei meiner Arbeit. Man kommt aus der Rolle heraus, in der man im Alltag häufig drin ist. Hier ist es unmittelbar, frei, man kann improvisieren, reagieren. Jemand macht etwas und in dem Moment, wo er etwas macht, weiss ich noch nicht, was ich mache. Man erfindet das Leben gerade in dem Moment.
Das ist auch eine Kunst. Es ist zum Beispiel überhaupt nicht klar, wann man mit Humor reagieren sollte und wann nicht. Einmal gab es einen Konflikt am Esstisch. Ich habe nichts gesagt, mich einfach gebückt, die Schuhe ausgezogen und neben den Tisch hingestellt. Alle haben komisch geschaut: was macht der denn? Da war der Konflikt bereits vorbei. Stell dir das mal vor in einer politischen Diskussion.
Ein Fernsehreporter wollte unser Heim aus Sicht eines Bewohners proträtieren. Da gibt es eine spezielle Szene. Max filmt und benennt alle Dinge und Menschen, die er kennt: Patrick, den Eimer, Peter… alles völlig auf der gleichen Ebene. Dinge und Menschen sind für ihn etwa das Gleiche. Er ist einfach so, sein Leben ist einfach anders. Die zentrale Aufgabe ist, ansatzweise zu verstehen, wie seine Welt aussieht, die Emotionen nachvollziehen zu können. Man selbst wird dadurch auch ein Teil seiner Welt, man ist selbst anders. Man merkt, man könnte das Leben ganz anders anschauen, wenn man zum Beispiel den Kübel so anschaut wie Max.
Im letzten Sommer haben wir Geschichtenbücher auf die Reise geschickt. Eine Person schreibt eine Geschichte und gibt das Buch an eine andere Person weiter. Ist das Buch voll, wird es an uns zurückgeschickt. Dies ist eine Geschichte aus dem Geschichtenbuch Nr. 4.
«Kann ich Sie mal was fragen», fragte der Mann. Da diese Frage immer mit Ausgaben verbunden ist, mag ich sie nicht. Aber es war ein Sommertag, und ich hatte gerade mit einer Freundin bei einem Kaffee vor dem Landesmuseum die Welt neu sortiert und als besseren Ort hinterlassen. Die Sonne strahlte, die Bäume grünten, die Limmat schimmerte, und ich dachte zum x-ten Mal, was für ein Luxus dieses saubere Wasser ist. Weil sich also alles gerade so wohlfeil anfühlte, blieb ich stehen und sagte tapfer: «Ja, bitte.» Der Mann vor dem Dim-Sum-Kiosk stieg von seinem Fahrrad. Auf dem Rücken trug er einen Rucksack, auf dem Gepäckträger eine gröbere Stoffwurst.
«Wie komme ich nach Zug? Ich will über den Gotthard ins Tessin fahren.»
Echt jetzt? Imitierte da einer Eugens Frühlingslagerheimfahrt, in umgekehrter Richtung? Aber wie sollte einer seiner Generation Klaus Schädelin kennen? «Also…», begann ich und schaute in sehr blaue Augen. Tja, wie fährt man vom Hauptbahnhof ohne Zug nach Zug? «Vielleicht am besten…»
«…der Sihl entlang», sagte ein zweiter junger Mann, der plötzlich neben uns aufgetaucht war. «Du fährst bis nach Sihlbrugg, dann fragst du weiter.» «Gut», sagte der erste Mann, «dann fahre ich jetzt also diesen Fluss da runter…» «Nein», riefen der zweite Mann und ich wie aus einem Mund, «das ist die Limmat. Die Sihl ist dort drüben. Und nach Zug geht’s nicht flussabwärts, sondern flussaufwärts.»
Der erste junge Mann nickte, setze sich auf den Sattel – und weg war er. «Wo kommen Sie denn eigentlich her?», rief ich ihm nach. Zu spät! Die blauen Augen waren bereits vom Autoverkehr aufgeschluckt. Mit dem restlichen jungen Mann überquerte ich den Fussgängerstreifen. Auch er besass ein Velo, das er ans Geländer angebunden hatte. «Haben Sie uns gehört und sind extra über die Strasse gekommen?», fragte ich. «Also weisst du», sagt er und warf seine Dreadlocks über die Schultern, «ich finde das jetzt schon irgendwie speziell. Heute hat doch jeder ein Handy mit GPS. Und da fährt einer durch die Schweiz und hat noch nicht einmal eine Landkarte. Cool, oder.» Er löste die Kette seines Fahrrades, das etwa so viele Jahre zählte wie sein letzter Haarschnitt, schaute mich an und sagte: «Du, kann ich dich mal was fragen?» Diesmal kam ich nicht mit billigem Rat davon.
Geschichte Nr. 1 aus unserer Reise ins El-Comedor-Universum.
Lebensmittel sind mir sehr wichtig. Mir ist wichtig, woher sie kommen, wie sie hergestellt werden und wer dahintersteht. Und ich möchte mitbestimmen können, welche Lebensmittel ich beziehen kann. Immer in den Bioladen zu gehen war für mich zu teuer und Supermärkte sind mir nicht so sympathisch.
Bei Comedor bin ich zwei Jahre nach Gründung eingestiegen. Comedor ist eine Food-Kooperative, die alle drei Monate Haushalte mit haltbaren Produkten beliefert. Im Moment bin ich Buchhalter und helfe bei der Verteilorganisation. Wie alle anderen Mitglieder mache ich alles freiwillig. Ich studiere und arbeite 60% in der Wirtschaftsprüfung. Insgesamt ist das für mich vielleicht eine 10-20%-Stelle.
Wir haben etwa 50 Bestellgruppen; Gross-WGs oder Zusammenschlüsse von Kleinhaushalten, die meisten im Raum Zürich. Alle drei Monate machen wir eine Sammelbestellung, ein Monat später kommt die Lieferung. Gemeinsam werden die Produkte während drei Tagen abgepackt, sortiert und an die Bestellgruppen ausgeliefert. Zwischen den Lieferungen lagern wir praktisch nichts, wir haben lediglich einen kleinen Lagerraum für Olivenöl und andere kleine Dinge. Das hilft, die Kosten tief zu behalten.
Wir wollen mit unserem Sortiment alles abdecken, was haltbar ist: Lebensmittel, Kosmetik, Hygiene. Die Ausgangsüberlegung bei einer Produkteinführung ist häufig: was möchte ich eigentlich lieber nicht mehr beim Detailhändler einkaufen? Dann machen wir uns auf die Suche nach einem Produzenten, der uns überzeugt. Wir schauen den Hof an und lernen die Leute kennen, um zu merken, ob es passt oder nicht. Wenn es irgendwie geht, wollen wir direkt von den Produzenten kaufen, ohne Zwischenhändler. Wir arbeiten auf Vertrauensbasis, bei kleineren Betrieben geht alles über einen persönlichen Kontakt. Wenn jemand aus Giuseppes Betrieb in Sizilien, von dem wir Orangen beziehen, stirbt, dann trauern wir mit. Wir sind nicht daran interessiert, Preise zu drücken. Es sollen anständige Löhne bezahlt werden können.
Comedor macht keinen Gewinn, es gibt keine Marge auf den Produkten. Wir können uns das leisten, weil wir kein Handelsbetrieb sind, der Profit erwirtschaften muss. Mit den 120 Franken pro Bestellgruppe pro Jahr decken wir lediglich unsere Fixkosten. Wir sind auch nicht daran interessiert, sinnlos zu wachsen. Es gibt keinen Vorteil für uns, mehr Umsatz zu machen. Wachsen ist zweischneidig: man hat zwar ein grösseres Gewicht, aber es wird komplizierter, man braucht eine grössere Logistik. Wir wollen deshalb organisches Wachstum, aber nicht mehr.
Wenn man alle Lebensmittel im Bio-Laden kauft, ist es teuer. Da zahlt man auch dafür, dass der Laden sehr schön ist. Viele Leute können es sich nicht leisten und gute Lebensmittel werden zum Luxusprodukt. Dank der grossen Bestellmengen sowie keinerlei Ausgaben für Werbung, Läden oder Personalkosten können wir tolle Lebensmittel zu guten Preisen verkaufen. Dafür muss man sich für die Lagerung von grösseren Mengen einrichten und ab und zu sollte man beim Verteilen mithelfen, auch wenn das kein Muss ist. Comedor ist Bio für jeden. Bio ist für mich aber nicht das Hauptargument; saisonal, regional und sozial sind für mich eigentlich wichtiger.
Ich koche wirklich gerne, probiere neue Lebensmittel und Rezepte aus, gehe auf den Markt, um ein Suppenhuhn zu kaufen. Ich habe jetzt auch meinen eigenen Sauerteig, den «Hermann», den mir jemand aus meiner Comedor-Bestellgruppe geschenkt hat. Mittlerweile bin ich ein wenig wie meine Grossmutter.
Anfangs war es vor allem schwierig sich gegenseitig zu finden. Es wusste gar niemand, dass unsere Gruppe existierte. Dann war es aber mega lässig, wie schnell viele Helfende dazukamen. Wir haben einen Flyer gemacht, den viele Freiwillige im Schnelltempo an allen Türen im Kreis 3 in Zürich aufgehängt haben, Strasse für Strasse. Zuerst haben wir die Hilfe über Facebook und Chat organisiert, das wurde aber schnell unübersichtlich. Also haben wir ein Formular erstellt, wo man sich eintragen konnte, wenn man Hilfe suchte oder Hilfe anbieten wollte. Ausserdem richteten wir ein Telefon ein, um auch für Menschen ohne Internet besser erreichbar zu sein. Es bildete sich ein Koordinationsgrüppli von zehn Frauen, in dem wir schauten, dass zu Bürozeiten immer jemand erreichbar war. Die Leute riefen an, «ich bräuchte jemanden zum einkaufen in den nächsten zwei Tagen». Ich schaute also in der Liste, wer in der Nähe wohnt, wer das übernehmen könnte. Das Ganze war, wie vieles in dieser Zeit, irgendwie surreal: Auf der einen Seite war ich zuhause fürs Studium am Lernen und auf der anderen hatte ich Telefondienst und habe Hilfeleistungen koordiniert.
Ich hatte ein Telefon mit einer Frau, das mich sehr berührte. Ich erklärte ihr, was wir tun und sie meinte: mega lässig, sie sei sehr einsam, normalerweise kämen ihre Kinder und Grosskinder zu Besuch und brächten ihr Blumen. Und so ein Blumenstrauss, das wär schon schön. Später rief sie wieder an und bedankte sich bei uns und sagte, wie sehr sie sich über die Farbe in der Stube freute. Es gab allgemein so viel Dankbarkeit, das habe ich früher weniger erlebt. Viele Leute riefen gar nicht in erster Linie wegen einem Grundbedürfnis an. Bei vielen Leuten fielen Sozialkontakte ganz weg. Sie hatten ein Bedürfnis, zu reden und wir versuchten, diese Möglichkeit zu geben. Eine ältere Frau erzählte, wie ihre Grosskinder einmal pro Woche mit dem Einkauf vorbeikämen, sie lasse vom Balkon einen Korb runter, dann schwatzen sie noch ein Halbstündli von oben. So schön, wie man sich trotz physischer Distanz nah bleiben kann, auch ohne Zoom und Skype. Ich gehe immer zur gleichen Zeit einkaufen und beim Nachbarshaus hat’s immer ein älteres Ehepaar, die freundlich grüssen. Ich habe in dieser Zeit das erste Mal wirklich mit ihnen geredet. Es macht so Freude, wenn jemand ohne besonderen Grund freundlich ist. Auch sonst bin ich mir meiner Nachbarn bewusster geworden. Wenn man feststeckt, fällt einem plötzlich auf, wie schön ein Spaziergang im Quartier ist, bei dem man noch mit einigen Nachbarn reden kann. Ich glaube, man ist sich auch sonst vielen Sachen bewusster geworden, weil man Zeit hatte über 100 Dinge nachzudenken.
Ich fand die Solidaritätswelle sehr schön und ich hoffe fest, dass sie jetzt bleibt. Es geht ja nicht nur um die klassische Risikogruppe, sondern zum Beispiel auch um Leute, die keinen Job mit festem Vertrag haben, zum Beispiel Sans-Papiers. Es war extrem, wie viele Menschen die Essensausgaben in Zürich und Genf in Anspruch nahmen. Und was mir mega wichtig ist, dass man schafft, die Solidarität auszuweiten, nicht nur beim eigenen Grosi oder dem Grosi der Kollegin, auch auf Asylsuchende, Menschen in Lagern auf Lesbos, dass diese Solidarität nicht an der Landesgrenze haltmacht.
Mittlerweile kommen weniger Anfragen, die Telefonzeiten haben wir reduziert. Längerfristig ist die die Idee, dass es einfach über den Chat läuft. Wir arbeiten jetzt auch mit der institutionalisierten Nachbarschaftshilfe des Kreis 3 zusammen und ich hoffe, dass viele unserer Helferinnen sich dort anmelden und weitermachen. Mein Ideal für die Zukunft ist, dass auch die Anfragen breiter werden, dass die Leute sich auch melden, wenn sie eine Saftmaschine brauchen.
Neben meiner beruflichen Tätigkeit als Physiker in einem Windenergie-Projekt unterrichte ich seit bald zwei Jahren Taichi. Mit Corona kam das Homeoffice und auch das Unterrichten war nicht mehr so einfach. Ich wohne in einer grossen WG und die meisten von uns waren plötzlich viel öfter zuhause. Es kam in unserer Gruppe der Wunsch auf, dass man etwas von sich zeigen könnte, sich gegenseitig Dinge beibringt. Wir wollten uns so besser kennenlernen und zusammen Neues erleben. Als das Interesse entstand, dass ich Taichi zeigen solle, habe ich gezögert. Ich musste mir zuerst klarwerden, was das Ziel ist. Normalerweise gebe ich Interessierten einen ersten Einblick, damit sie entscheiden können, ob sie regelmässig und langfristig am Training in meiner Gruppe teilnehmen möchten. Nur einen Einblick geben und danach bleibt es offen, was man damit macht, das ist normalerweise nicht mein Ding.
Darum war ich unsicher, ob ich in der WG unterrichten sollte. Hier wusste ich, dass es temporär ist und dass nicht alle eine klare Absicht haben, sondern mitmachen, weil es sich halt anbietet. Es gibt andere Aktivitäten, die kann man einmal machen und man hat unmittelbar etwas davon. Zum Beispiel funktionieren manche Dehnungs- oder Entspannungsübungen relativ einfach, man macht sie und der Körper fühlt sich besser an. Beim Taichi ist es anders, der Körper beginnt sich manchmal erst nach längerer Übungspraxis wohl zu fühlen. Es sind komplexe und herausfordernde Bewegungen und Abläufe, die man zu bewältigen hat. Der Nutzen wird es mit der Zeit deutlicher, und es ist auch nicht mein Ziel, eine Art von schnellem Nutzen zu ermöglichen.
Warum ich schliesslich doch zugestimmt habe? Wegen Corona sind wir als Gruppe zusammengewachsen, es sind engere Beziehungen entstanden. Ich hatte das Gefühl, Taichi-Unterricht anzubieten ist eine Möglichkeit, mich zu öffnen und meinen Mitbewohnern zu erlauben mich näher kennen zu lernen. Ich fand es schön, wenn auch ein bisschen gewagt, etwas so Persönliches, das so wichtig ist in meinem Leben, mit ihnen zu teilen. Wir haben dann zweimal pro Woche während sechs Wochen zusammen trainiert. Die Mitbewohnerinnen und Mitbewohner waren sehr offen, was ich nicht selbstverständlich fand. Sie kämpften mit sich, merkten dass die Bewegungen ganz anders herauskamen als gewollt und probierten trotzdem weiter, auch nach vielen Versuchen blieben sie offen und neugierig. Das hat mich tief berührt. Ich hatte das Gefühl, verstanden zu werden, in meiner Faszination für Taichi.
Mit den Lockerungen des Lockdown kam dann das Ende des WG-Unterrichts. Wir hatten es ja von Anfang an als temporäre Aktion geplant. Ich habe mich am Schluss der letzten Stunde für das Vertrauen meiner Schülerinnen und Schüler bedankt. Sie haben mir vertraut und ich ihnen. Mit ihnen zu arbeiten war eine schöne Erfahrung, die unsere Beziehung auf eine andere Ebene gebracht hat.
Seit einem Jahr lebe ich ohne Tierprodukte. Das war für mich wie ein Befreiungsschlag, die Lösung eines inneren Konflikts. Lange Zeit legte ich mir Stories zurecht, weshalb ich Tierprodukte konsumiere, obwohl ich immer mehr darüber erfuhr, mit welchen Problemen die Produktion verbunden ist. Ich habe mir gesagt, ich kaufe doch nur Schweizer Produkte, ich hatte das Gefühl, Bio ist heilig, auch wenn der Unterschied für Tiere minimal ist. Oder ich habe mir gesagt, ich allein kann nichts ausrichten, es hilft sowieso nichts.
In meinem Studium, Agrarwissenschaften, hatte ich eine Vorlesung, die unsere Landwirtschaft aus Sicht der Tiere beleuchtete. Wie wir Kühe künstlich im physiologischen Zustand des Mutterseins behalten, damit sie weiter Milch geben. Diese Tragödie der Mutter ohne Kind, das war für mich erdrückend. Meine Rationalisierungen sind in meinem Kopf eine nach der anderen zerbrochen und der einzig logische Schluss war, mein Verhalten zu ändern. Meine Familie, mein Partner und auch meine Freunde haben zumindest anfangs nicht so empfunden wie ich. Das hat mich erstmals in eine Krise gestürzt. Ich habe mich in meine Bachelorarbeit zum Thema Tierwohl gekniet, mich total überarbeitet, weil ich das Gefühl hatte, ich muss für all diese Probleme jetzt eine Lösung finden.
In dieser Zeit begann ich mich für die Klimastreikbewegung einzusetzen. Das war für mich die Rettung, wie ein Ventil. Es war unglaublich wichtig zu merken, dass ich in meinem Empfinden nicht allein bin. Die Bewegung hat mir erlaubt, aus einer Starre zu entkommen. Ich versuche, ein gutes Beispiel zu sein, dem Gesagten ein Gesicht zu geben. Den Leuten zu sagen, dass die Lage ernst ist und gleichzeitig Hoffnung zu geben, zu zeigen, mir geht es gut, ich lebe ein gutes Leben. Ich esse gutes Essen, es ist tierquälfrei, kommt von Personen, zu denen ich Vertrauen habe.
Mit Leuten zu sprechen, die nicht meiner Meinung sind, das ist mir unglaublich wichtig. Du siehst freundliche Gesichter und merkst, die Leute haben ihre Sorgen, Verantwortung, eine andere Ausbildung und andere Hintergrundgeschichten. Manchmal fällt es mir schwer, nicht sehr hart ins Gericht zu gehen. Ich versuche mich dann in die anderen Schuhe zu versetzen, und ich rufe mir in Erinnerung, wie ich vor zwei Jahren war. Man muss eine Kommunikation finden, die weniger hässig ist, wo man sich weniger angegriffen fühlt. Ich bin nicht der Typ für ein hohes Level an Konfrontation. Man darf die Kommunikation nicht abbrechen lassen. Wenn die Leute zurückkommen und erzählen, dass sie etwas ausprobiert haben, das freut mich sehr.
Mein Traum ist es, eine Welt zu haben, in der wir die Rahmenbedingungen so gesetzt haben, dass man geniessen kann, für was auch immer man sich entscheidet. Ein Kollege hat’s schön gesagt: eine Welt, wo man nicht 300-mal am Tag die richtige Entscheidung treffen muss. Ich bin unglaublich froh, mit der Klimastreikbewegung eine Homebase zu haben, wo ich Energie tanken kann. Es gibt ja Geschichten von Menschen, die unter den schwierigsten Umständen Heldentaten vollbracht haben. Das ist nicht meine Geschichte. Ich hatte so viel Glück, eine super liebe Familie. Ich kann rausgehen und mich einsetzen. Das funktioniert nur, weil ich zurückgehen kann in ein unterstützendes und liebevolles Umfeld.
Das Foto haben wir ganz am Anfang der Corona-Schliessung gemacht. Der Mae-Geri ist eine Fusstechnik, bei der die Kraft gerade nach vorne wirkt. Das Bild haben wir gewählt, weil es schön komponiert ist, aber die beabsichtigte Wirkung des Tritts sieht man eigentlich nicht. Man sieht nur die Rolle, die in die Höhe saust, und nicht diejenige, die nach vorne wegfliegt. Auf Bildern siehst du all die kleinen Fehler in der Haltung. Die eine Hand ist nicht an der Hüfte oder das Becken nicht vorne. Du fragst dich dann, was eigentlich wichtig ist: die korrekte Form oder der effiziente Fusstritt. Ich finde die Wirkung wichtig. Aber wir lernen die korrekte Form, und das macht auch Sinn. Irgendwann muss es halt zusammenpassen. Es gibt ganz verschiedene Arten, wie man Karate machen kann, zum Beispiel sind da die Hau-Drauf-Leute. Mir ist es wichtig, dass man auch die spirituellen, mentalen und gesundheitlichen Aspekte lebt. Sei höflich und bescheiden, vervollkommne deinen Charakter und so weiter. Auch wenn man bei uns die Regeln, das Dojo kun, nicht vor jedem Training aufsagt, die Philosophie stimmt.
Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, ist da oft Rambazamba. Deshalb geniesse ich es, regelmässig zu meiner Karate-Familie ausbrechen zu können. Das ist meine Familie neben der Familie. Die Leute sind sehr unterschiedlich, aber man trifft sich regelmässig, und alle sprechen die gleiche Sprache, dieses Karate-Japanisch. Der Wochenrhythmus gibt mir Struktur im Leben. Unterwegs ins Training hallt der Alltagstress manchmal noch nach. Aber dann ziehe ich den Karate-Anzug an. Ich denke immer noch: Was bin ich müde! Eigentlich kann ich nicht mehr. Aber dann gehe ich hoch in die Halle. Wir machen am Anfang des Trainings immer Mokusō, eine kurze Meditation. Damit ist der Schalter umgelegt. Die gestauten Sachen im Kopf verschwinden. Ich tauche ein und der ganze Alltag ist wie weggedrückt. Der Trainer steht vor uns und er spricht unsere Karate-Familiensprache. Wenn wir gegeneinander frei kämpfen, bin ich immer ganz aufgeregt, es putscht mich hoch und ich fange schon vor der ersten Bewegung an zu schwitzen. Es ist die totale Konzentration, ich bin komplett im Hier und Jetzt. Nach dem Training bin ich tiefenentspannt, ich bin mit mir zufrieden. Und Karate macht mir einfach Spass.
Ich bin nicht so ehrgeizig, den schwarzen Gürtel konsequent zu verfolgen, ich mache Karate für mich. Der ständige Kampf für die Form bzw. gegen sich selbst ist aber sehr anstrengend. Man hat ja schon so oft einen Zuki gemacht, vielleicht 100’000 Mal. Aber je mehr man weiss, wie es sein sollte, desto mehr weiss man, wie weit man von einem perfekten Schlag entfernt ist. Dann sage ich mir: Der Weg ist das Ziel. Das ist cool, wenn man es entspannt nehmen kann, sonst ist es Stress. Dafür entwickelt man sich als Person weiter, es kommt die mentale Ebene dazu, wenn man nicht nur die Bewegung im Auge hat, sondern sich auch mit der Philosophie auseinandersetzt.
Während Corona habe ich wenig trainiert, je länger es dauerte, desto mehr schwand die Motivation. Ich backe viel mehr feine Cookies, nach Corona rolle ich mich dann in die Halle. Ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich wieder losgeht mit dem Training vor Ort, dass ich wieder in den Rhythmus finden kann und meine zweite Familie treffe.
Zuhause habe ich immer einen Stapel Kleider. Kleider von meinen Söhnen und Enkelkindern, die alle darauf warten, geflickt zu werden. Begonnen habe ich das, als meine Kinder noch klein waren. Ich habe alles geflickt, was man flicken konnte. Fortwerfen konnte ich einfach nichts und es war mir eine Freude, dem, was andere Leute wegwerfen, neues Leben zu geben. Wir hatten damals auch nicht so viel Geld und das hat natürlich geholfen, aber eigentlich war das Geld nicht ausschlaggebend. Als ich und meine Söhne einmal in der Post in der Schlange am Warten waren, sagte eine Frau zu mir: «Sie, ich muss ihnen etwas sagen. Die Hosen ihres Sohnes, die sind wirklich toll, fünf Mal mit einem «Blätz» geflickt, so etwas sieht man heute nur noch selten». Ich habe das eigentlich immer als selbstverständlich empfunden.
Meine Söhne haben irgendwie verinnerlicht, dass man Dinge flicken kann. Sie wünschen sich von mir nun jedes Jahr Flickgutscheine auf Weihnachten, und sie haben gemerkt, dass das dann doch nicht selbstverständlich ist, dass ich das mache. Die Flickgutscheine gestalte ich immer anders; zum Beispiel als farbige Kartonkarten, die ich durch Nähen ohne Faden in Blöckchen zum Abreissen verwandle oder mit verschiedenfarbigen Fäden genäht. Für mich ist das eigentlich symbolisch, aber mein älterer Sohn nimmt das sehr ernst. Als ich einmal für meinen jüngeren Sohn etwas flickte, obwohl er eigentlich keinen Gutschein mehr hatte, meinte der Ältere entrüstet: «Geht’s noch?! Flicken ohne Gutschein?!»
Ich war schon immer gerne daheim, aber trotz meiner Pensionierung nie in dem Mass wie jetzt. Sonst habe ich die ganze Zeit Termine, Yoga, kochen in der Kirchgemeinde, Tavolata bei uns im Haus, Freunde treffen. Das ist jetzt alles weit weg. Nur meine zwei ehemaligen Bürokollegen besuche ich regelmässig, die haben beide schwere Krankheiten. Gerade heute Nachmittag gehe ich dorthin. Aber sonst habe ich tagelang keinen Termin, nüt, gar nüt.
Nun geht ja zum Glück die ETH-Bibliothek wieder auf. Ich stöbere halt immer noch gerne in der Wissenschaft herum. Wenn ich etwas lese, Fachliteratur und so, dann muss ich einfach etwas daraus machen. Ich arbeite deshalb jetzt gerne an meinem Blog «zukunftvoralter», der Untertitel heisst «Gedanken und Beiträge zur Zukunft von einem alternden Chemiker». Im Januar habe ich den ersten Beitrag gepostet. Wegen Corona habe ich jetzt genug Zeit dafür. In einem Blog-Artikel habe ich mein Leben als Zeitraum genommen, um verschiedene Entwicklungen aufzuzeigen. Als ich geboren wurde, träumte meine Mutter von einer Waschmaschine und der Vater von einem Auto, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre lag noch bei etwa 290 ppm, wie schon vor 500’000 Jahren, als der Mensch das Feuer entdeckte. 72 Jahre später ist die Konzentration 415 ppm, praktisch jeder Haushalt hat eine Waschmaschine und dazu noch einen Tumbler und die Zahl der Autos ist etwa 35 Mal so gross.
Der Beitrag endet damit, dass unsere Generation weg vom Konsum und hin zu immateriellen Werten kommen sollte. Ich zum Beispiel habe schon immer gerne gesungen, nun macht meine Partnerin auch mit. Vor Corona gingen wir dafür in die Volkshochschule. Wir haben dort einfach gesungen, ohne grosse Stimmbildung und weiss der Tüfel was. Zum Beispiel lernten wir einen lappländischen Jodel, oder Mani Matter, «dene wo’s guet geit, giengs besser…», und zäuerle, aber das hatte ich nicht so gern. Der Chorleiter bedient uns jetzt im Internet mit Gesangsanleitungen. Meine Partnerin und ich studieren die Anleitungen zuerst je einzeln. Dank Corona singen wir dann a capella im Duett, das hätten wir sonst nie geschafft.
Während den Ferien tränke ich meinem Bruder die vielen Blumen auf dem Balkon. Er hat nur eine kleine Giesskanne mit dünnem Hals. Einmal habe ich ihn gefragt: weshalb hast du nicht mehr Giesskannen oder solche mit grösserer Öffnung? Das ist doch ineffizient, das würde mich wahnsinnig machen, wie langsam das geht. Er sagte erstaunt: Beim Giessen schaue ich ja die Blumen an.
Gestern hatte ich ein Treffen mit acht Leuten auf einer virtuellen Plattform. Die Gruppe beschäftigt sich damit, ein Bildungsangebot im Bereich der Gemeingüter oder Commons, wie es in Englisch heisst, zu erarbeiten. Gemeingüter sind Dinge, die alle Menschen brauchen, wie Kultur, Sprache oder natürliche Ressourcen. Wir möchten ein möglichst offenes Format schaffen, für alle zugänglich, aber man soll trotzdem etwas vorweisen können, wenn man das Angebot absolviert hat.
Angefangen hat diese Initiative letzten Sommer, als sich zwei Leute mit einem Commons-spezifischen Hintergrund trafen. Nun gibt es regelmässige Treffen, neuerdings halt eben im virtuellen Raum. Beim ersten Mal war es schwer für mich. Ich war zweieinhalb Stunden online, mit lauter Leuten, die ich nicht kannte. Im echten Leben holt man sich zum Beispiel einen Kafi und plaudert zufällig mit jemandem. Es ist im virtuellen Raum fast unmöglich, einen persönlichen Austausch zu haben. Normalerweise sind diese Plattformen für den virtuellen Austausch ja sehr hierarchisch organisiert, man hat nicht viel Freiheit, wann man mit wem spricht.
Wir haben deshalb eine Untergruppe gegründet, die sich genau damit beschäftigt und nach besseren Formen sucht. Wir haben nun eine technische Lösung gefunden, dass die Leute auch online selber wählen können, in welchen sogenannten Breakout Rooms sie über bestimmte Themen mitreden oder mit wem sie einfach ein bisschen plaudern wollen. So traf ich im Hauptraum eine Person, die dort wartete, da sie sich erst später eingeloggt hatte. Wir kamen spontan ins Gespräch, dann kam eine weitere Person dazu. Es war ein spannender Austausch und wir haben uns ganz gut kennengelernt. Genauso wie wir es uns vorgestellt hatten, war es trotzdem nicht, es gab immer noch ein paar technische Probleme und es ist auch im Sozialen etwas anderes, man spürt die Leute nicht auf die gleiche Art, wie wenn man sich persönlich trifft. Aber es war viel besser als beim ersten Anlass, wo wir noch keine solchen Vorkehrungen getroffen hatte.
Ich bin der einzige aus der Schweiz, die anderen sind verstreut über Deutschland. Die Möglichkeit, sich virtuell auszutauschen, ist cool, weil so viel regelmässiger alle teilnehmen können. Wahrscheinlich wird es sich auf lange Sicht etablieren, dass es beide Formate braucht, das persönliche Treffen und die virtuellen Formate. Corona hat uns da neue Möglichkeiten eröffnet, die Zusammenarbeit zwischen entfernten Personen ist einfacher geworden.
Für die Sitzung von gestern haben wir abgemacht, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich einen schönen Platz suchen, etwas zu essen und trinken mitnehmen und sich anziehen, als würden sie aus dem Haus gehen. Wir wollten, dass es nicht einfach das x-te Online-Meeting ist, sondern den Anlass ein bisschen zelebrieren. Zum Start haben wir den Raum gezeigt, wo wir sassen. Eine war genau dort, wo das erste physische Treffen der Gruppe stattgefunden hatte und hat ein bisschen davon erzählt. Das hat uns, die wir damals nicht dabei waren, ein Bild gegeben, wie es ausgesehen hat, es war dadurch nicht ganz so abstrakt. Eine andere Teilnehmerin hat sich schön geschminkt und ein lustiges Hemd getragen, wieder andere haben ein bisschen Dekorationen aufgehängt oder auffälligen Schmuck angezogen.
Ich selber habe im Cheminée ein Feuer gemacht und mich im Fauteuil davorgesetzt. Ich fand es sehr cool. Oft gehst du ja manchmal direkt aus dem Bett vor den Bildschirm, ungekämmt und in den Pijamahosen. Der Auftrag, man solle sich ein bisschen hübsch machen, und die Möglichkeit, zufällig auf Leute zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen, hat viel Menschliches in die Virtualität gebracht.
Wer kennt sie nicht, die stinkenden lachsrosa oder gelben Waffellappen aus Kunststoff, oder die baumwollenen mit Streifen, die nach ein paarmal waschen dünn und fadenscheinig sind und sich auflösen. Fürs ungeliebte Abwaschen käme es ja niemandem in den Sinn, eine bessere Lösung zu erfinden. Aber ich habe eine gefunden: ich stricke meine einfach selbst. Eine bunte Beige handgestrickter Abwaschlappen im Schrank ist ein wunderbarer Anblick. Sie sind nicht nur schön, sondern es macht auch Freude, sie zu benutzen. Sie haben genau die richtige Dicke, sind griffig und robust, gerade rauh genug, um den Dreck vom Teller zu bekommen und gleichzeitig schön weich. Auch nach Jahren im Dienst und ungezählten Waschgängen funktionieren sie tadellos. Auch als kleine Geschenke sind sie rundherum begehrt. Ein besonderer Luxus für eine lästige Pflicht im banalen Alltag!
Nach meinem Jusstudium habe ich ein Gerichtspraktikum gemacht, mich für die Anwaltsprüfung vorbereitet, der klassische Karrierepfad eben. Ich war mir nicht mal sicher, ob ich je als Anwältin arbeiten möchte, aber ich fand damals, ich mache die Anwaltsprüfung lieber jetzt, sonst bereu ich es später vielleicht. Vielleicht hatte das auch damit zu tun, mich beweisen zu wollen.
Ich habe einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Ungerechtigkeit ist etwas vom Schlimmsten für mich. Recht ist für mich primär etwas sehr Politisches und vielfach ist es historisch bedingt, weshalb die Rechtslage so ist und nicht anders. Ich hinterfrage oft kritisch, versuche, das Grosse und Ganze zu sehen. Im Strafrecht habe ich zum Beispiel meine eigene Skala, welche Delikte ich schlimmer finde als andere. Das ist nicht immer nur einfach, wenn man als Anwältin der Meinung ist, das Recht sollte eigentlich anders sein.
Ich habe den Anspruch, dass man aufrichtig ist und ehrlich. Schlammschlachten machen mir Mühe. Wenn, dann bin ich eher der Mediationstyp: Ja, wir haben ein Problem und wir finden uns irgendwo in der Mitte, es bringt nichts, sich tausend Jahre zu streiten. Ich finde, dass man als Anwalt nicht alles auf Biegen und Brechen probieren muss. Zu häufig wird das Recht dazu benutzt, dass man Dinge versteckt, die Karten nicht auf den Tisch legt, sich Recht zum Vorteil macht, obwohl Sinn und Zweck eigentlich etwas anderes wären. Wenn ich gewinnen möchte, weil ich davon überzeugt bin, im Recht zu sein, weil alles andere ungerecht wäre, bin ich viel kampfeslustiger, dann versuche ich alles und halte mich am kleinsten Hoffnungsschimmer fest.
Je länger, desto mehr möchte ich nur noch Sinnvolles machen, auch wenn ich nicht immer weiss, was das ist. In der letzten Zeit habe ich mich immer weniger als Anwältin gesehen. Wenn, dann würde ich nur Umweltmandate betreuen wollen, aber das war für mich häufig auch unbefriedigend. Weil es um sehr spezifische Dinge geht, wie zum Beispiel ein Memorandum darüber schreiben, wie eine Gesetzes- oder Verordnungsbestimmung auszulegen ist. Ich habe das Bedürfnis, freier zu arbeiten, aktiv mitzugestalten. Als Anwältin kommst du häufig erst dazu, wenn irgendwo bereits ein Problem besteht, das du nicht selbst kreiert hast. Der Blick fürs Grosse und Ganze geht dann leider häufig verloren.
Den Job bei der Kanzlei habe ich gekündigt. Rein menschlich war alles cool, aber Zeit wird mir je länger desto wertvoller. Ich möchte nicht irgendeinem Bild entsprechen, ohne dabei leidenschaftlich zu sein. Was mir besser entspricht, weiss ich noch nicht. An einer Hochschule durfte ich vor kurzem eine Vorlesung halten. Als ich sah, dass die Studentinnen und Studenten mir zugehört, mich verstanden haben, hat mich das sehr motiviert.
Wenn ich nun beruflich nicht etwas anderes finde, was mir mehr entspricht, wäre der «Worst Case» in meinem Fall, dass ich mich wieder als Anwältin anstellen lassen müsste oder mich als Anwältin selbständig mache. Das wäre ja immer noch ein sehr guter «Worst Case». Dass es ein riesiges Privileg ist, dass ich nun versuchen kann, andere Dinge zu tun, als 100% im Büro als Anwältin zu arbeiten, bin ich mir bewusst. Aber das ist für mich kein Argument, nicht auszuprobieren, ob man das Leben auch anders gestalten kann, mit weniger Geld, weniger Status, weniger Stress. Manchmal habe ich schon das Gefühl, ich sei ein Weichei und mag vielleicht einfach nicht arbeiten, aber das stimmt nicht. Ich brauche einfach etwas, was mich mehr motiviert. Ich brauche Sinn und gleichzeitig auch mega viel Unsinn, ganz im freien Sinn. Spass haben, lustig sein, Sinnvolles im Kleinen machen und mitgestalten. Ich möchte etwas mit Leuten machen, die ich mag, die ähnlich denken, die auch unglücklich sind in dem, was sie tun, und die Veränderung suchen.
Ich habe ganz vergessen euch von unserer nachhaltigen Strandküche auf Ischia zu erzählen: Im 100 Grad heissen Sand – wegen dem Vulkan! – garte unser Essen, während wir ins Meer schwimmen gingen. Danach in Ruhe essen war schwierig, so viele Touristen schauten uns begeistert zu, weil es so einfach ist. Auch Ostereier kochten wir! Als Nest dienten unsere Strandtücher.
Wer kann in der Schweiz schon von sich sagen, er habe einmal einen Bahnhof gebaut? Ich! Und es ist jetzt ein Baudenkmal von nationaler Bedeutung, dabei steht es nicht einmal am ursprünglichen Ort. Ursprünglich war es eine der beiden Personenhallen des ersten definitiven Bahnhofs von Basel, 1860 erbaut, damals die grösste freitragende Halle der Schweiz, 100 Meter lang und 20 breit, eine geniale Konstruktion aus Eisen und Holz. Als dort 1902 der heutige Bahnhof erbaut wurde, musste sie nach Olten zügeln, wo gerade Hallen gebraucht wurden – damals war Material teuer und Arbeit billig – und diente über hundert Jahre als Lagerhalle. Nach einer beim Biertrinken entstandenen Idee und einer langen Geschichte von Irrnissen und Wirrnissen haben wir 2012 die Halle in Olten abgebaut und sie 2015 in Bauma aufgestellt. Noch heute läuft es mir kalt den Rücken herunter, wenn ich an den Moment zurückdenke, wo ich die für uns perfekte Halle das erste Mal auf einem Plan sah. Heute pilgern Leute aus ganz Europa an, um die Halle zu sehen.
Manchmal habe ich Lust auf ein Glace. Aber es ist leider kaum möglich, da etwas ohne Verpackung zu bekommen. Wenn ich mir dann doch eins gönne, geniesse ich es schon. Aber wenn ich dann das Kübeli in den Abfall werfen muss, fühlt es sich schlecht an und der Glace-Genuss wird nachträglich dadurch getrübt. Ich finde, der bewusste Umgang mit den Ressourcen ist einfach das Richtige, aus Respekt für die Umwelt.
Es gibt auch ganz schöne Geschichten, wenn man so drauf ist wie ich. Als ich in St. Gallen gearbeitet habe, ging ich jeden Morgen in einer Bäckerei beim Bahnhof ein Gipfeli kaufen. Es ist verrückt, man kauft ein Gipfeli und packt es schon beim Rauslaufen aus, beisst rein und wirft das Säckli vor der Türe in den Abfallkübel. Es hat nicht einmal eine Minute, nur ein paar Sekunden, seinen Dienst geleistet und weg ist es. Ich habe das Papiersäckli vom ersten Mal einfach jeden Tag wieder mitgebracht und liess das neue Gipfeli hineinstecken. Es ist zwar nur Papier, aber auch das braucht Ressourcen. Nach ein paar Wochen hat mir die Verkäuferin ein genähtes Stoffsäckli geschenkt. Meine Sorgsamkeit habe ihr gefallen. Ich freute mich sehr und habe lange studiert, was ich ihr im Gegenzug schenken könnte. Etwas Selbstgebackenes wäre eher eine schlechte Idee. Es kam mir nichts Schlaues in den Sinn. So habe ich sie zum Kaffee eingeladen und wir haben uns bestens unterhalten. Im Moment gehe ich nicht arbeiten, aber das Säcklein nutze ich weiter, ich packe die Gläschen mit dem Gemüsebrei und den Löffel für die Tochter darin ein.
Ich habe in Wädenswil Umweltingenieurwissenschaften studiert. Dort haben wir auch Ökobilanzieren gelernt. Für meine Tochter benutzen wir Stoffwindeln. Aus Umweltsicht sind diese leider nicht klar besser als normale Windeln. Lustig, aber auch tragisch, ich sage den Wegwerfwindeln automatisch normale Windeln. Ich wasche etwa jeden dritten Tag eine Sechziggrad-Maschine. Aber zum Glück können wir Ökostrom beziehen, dann ist es nicht so schlimm. Wir haben die Windeln von meiner Schwägerin bekommen, sie hat diese für ihr erstes Kind benutzt, und wir geben ihr die kleinsten bald zurück, weil dort das zweite Kind unterwegs ist. Die Windeln sind nicht mehr wie früher einfach Stoffblätze, sondern mit einer dichten Aussenhülle, Klettverschluss und Einlagen, ganz praktisch. Sie sind bunt und hübsch gemustert, mit Blüemli, Enten, Löwen etcetera. Und sie sind etwas dicker als die Wegwerfwindeln. Wir glauben, dass das Kind deswegen so früh schon sitzen konnte, weil es so ein schönes Polster am Füdli hat. Jetzt will es dafür einfach nicht mehr liegen und schreit, bis man es aufsetzt.
Wieso s’Velo? Da gibt es viele Gründe. Das Velo war mein erstes Fortbewegungsmittel. Es fasziniert mich, dass reine Muskelkraft mich so schnell, unkompliziert und gut fortbewegt, und es ist für mich einfach ein Kultobjekt. Gebastelt und getüftelt habe ich auch schon immer gerne. Ich bin jemand, der gerne etwas selbst macht oder sich aneignet, Autodidakt halt. Es geht so zwar oft länger, bis ich etwas verstehe, dafür weiss ich es aber dann. Zum Fachmann gehe ich nur selten. Ich nehme lieber was auseinander, bis ich den Mechanismus durchschaue. So kann ich auch mal locker einige Stunden mit einem Hinterrad verbringen. Im Nachhinein denke ich mir dann schon ab und zu: Mein Gott, jetzt habe ich so lange rumgeschraubt und es funktioniert doch nicht! Velos flicken braucht Zeit. Da muss man auch der Typ dafür sein, Beharrlichkeit gehört dazu, nicht so schnell aufgeben und an Feinheiten rumtüfteln. Für Spezialanfertigungen ist Kreativität nötig. Aber nicht nur dazu, denn die Teile von verschiedenen Velos passen ja oft nicht einfach so zusammen. Dann lasse ich mir meistens etwas einfallen. Unterdessen habe ich ein ziemlich umfangreiches Teilchenlager. Das braucht Ordnung und System. Nichts nervt mich mehr, als wenn ich etwas nicht mehr finde. Meine Werkstatt ist trotz Ordnung meistens ziemlich voll. Ich bin aber auch froh, dass ich nicht mehr Platz habe. So bin ich etwas zurückhaltender mit neuen alten Velos. Ab und zu finde ich beim Entsorgen Velos in Altmetall-Mulden und komme nicht selten mit mehr Material nach Hause als ich selber weggebracht habe. Zusätzlich bekomme ich auch immer wieder ausgediente oder nicht mehr gebrauchte Velos von Leuten aus der Nachbarschaft, von Freunden und Bekannten. Aus zwei bis drei alten oder defekten wird dann wieder ein fahrbares, das im besten Falle jemandem Freude macht.
Freunde, Familie, Bekannte, eine Stiftung, die Flüchtlinge betreut, und das Sozialamt der Gemeinde wissen davon, das schwätzt sich herum. Wenn jemand nach einem Velo fragt, dann habe ich meistens etwas. Es muss aber schon richtig passen. Ein Velo fährt man nur, wenn man es gerne hat und es einem gefällt. Farbe, Stil und Rahmenart müssen stimmen. Extras wie ein Körbchen hinten oder vorne, oder eine besondere Klingel dürfen natürlich gewünscht werden. Es ist schon spannend zu sehen oder zu erraten, wer welche Art von Velo fährt. Ich bin unterdessen ganz gut im Einschätzen, liege aber auch immer mal wieder daneben.
Für meine Velos verlange ich ein Sackgeld. Das Flicken und Herumbasteln soll ja schliesslich ein Hobby sein und kein Business. Mit dem Geld finanziere ich den Kauf von neuen Teilchen. Dafür ist ein Lieferservice im Preis inbegriffen. Ich habe ein Velo-GA, bin deshalb sehr mobil und verknüpfe die Lieferung jeweils mit einer kleinen Reise.
Wir lebten in der DDR und da gab es zwar alles, was man brauchte, aber keine große Auswahl und oft keine hübschen Sachen. Meine Schwester war 1961, vor dem Bau der Mauer, abgehauen. So nannten wir das damals.
Ich konnte einmal meine Schwester im Westen besuchen. Zu Verwandten ersten und zweiten Grades durfte man zu besonderen Festen, zum Beispiel Hochzeit, Taufe oder runde Geburtstage ab 60 Jahren, für ein paar Tage fahren. Wir gingen zusammen in Kaufhäuser, Sachen anschauen. Geld zum Kaufen hatte ich ja kaum. Aber die Kinderkleidchen hätten mir schon gut gefallen, ich hatte damals bereits Enkel. So habe ich ein kleines Heftchen in meiner rechten Hand versteckt, ich bin Linkshänderin, und insgeheim Skizzen der Kleidchen gemacht. Zuhause habe ich sie dann so gut ich konnte nachgenäht. Dazu nutzte ich vorwiegend Stoff aus getragener Kleidung, von wo denn sonst, aus dem Westen.
Die Familie hat sich über die exklusiven Kleidchen gefreut und wir hatten sowohl dem Westen als auch dem Osten ein Schnippchen geschlagen.
Ich bin ein Naturkind. Seit ich mich erinnern kann, faszinierte mich die Natur. Und am allermeisten faszinierte mich der Regenwald. Dieses einzigartige grüne Durcheinander, alles wächst übereinander, ineinander, für- und gegeneinander. Als ich klein war, sagte ich immer: Wenn ich gross bin, gehe ich in den Regenwald. Ich wurde zwar nicht sehr gross, aber doch erwachsen und hatte mittlerweile auch mein Biologiestudium beendet. Mitte Zwanzig habe ich ein Jahr im Regenwald in Südamerika verbracht, dort gearbeitet und gelebt. Ich habe mich selten so geborgen und aufgehoben, ja zu Hause gefühlt, wie in dieser Zeit. Umso stärker war seither das Bedürfnis, mich für den Regenwaldschutz einzusetzen. Spenden allein genügte mir aber nicht. Und so gründete ich vor einem Jahr den Regenwaldschutzverein Green Boots. Mittlerweile sind wir 13 Leute, die freiwillig mitarbeiten. Wir unterstützen Regenwaldprojekte vor Ort, sensibilisieren die Schweizer Bevölkerung für den Regenwaldschutz und engagieren uns politisch für mehr Regenwaldschutz in der Schweiz wie auch in Regenwaldländern. Seit unserer Gründung haben wir schon einiges erreicht. Wir haben eine professionelle Webseite, ein tolles Logo und starteten eine Crowdfunding-Kampagne zur Unterstützung eines spannenden Projekts in Ecuador. Und das alles nur mit ehrenamtlicher Arbeit und der Unterstützung vieler engagierter Personen, die uns ihre Fotos oder ihr Fachwissen zur Verfügung gestellt haben. Eigentlich wollten wir diesen Frühling unter die Leute und unseren Verein bekannter machen mit Standaktionen und anderen kreativen Ideen. Diese Aktivitäten liegen aktuell leider auf Eis. Aber wir sind alle super motiviert und bleiben dran. Zurzeit sammeln wir Spenden für ein zweites Projekt, diesmal auf Borneo.
Und ja, ich bin noch immer ein Naturkind und auch beruflich im Naturschutz tätig. Eine wunderbare Sache, wenn man seine Berufung schon als kleines Kind gefunden hat.
Innerlich war ich erstarrt. Die Arbeit hat für mich eine ausserordentlich grosse Bedeutung. Sie gibt Sinn und Bezug, definiert deine Person und gibt dir Selbstwertgefühl. Mit der Kündigung ist es so, als würde deine ganze Geschichte abgeschnitten. Und du fragst dich, ob alles schlecht war, was du getan hast? Ohne Arbeit hast du keine Anknüpfungspunkte an die Welt mehr, dir wird die Daseinsberechtigung weggenommen.
Ich war den grössten Teil meines bisherigen Berufslebens als Ingenieurin und Managerin im Bereich Wasserkraft tätig, einem global tätigen Anlagenbauer. In den letzten Jahren habe ich dort das Innovationsmanagement konzeptionell erarbeitet und eingeführt. Digitalisierung war ebenfalls mein Verantwortungsbereich, ich habe dazu mit meinen Kollegen die Roadmap erarbeitet und eine grosse Produktentwicklung geleitet. Es war ausserordentlich spannend und befriedigend, diese Themen bearbeiten zu können und ich glaube, ich war auch gut darin. Ich war direkt der Geschäftsleitung unterstellt. Dann wurde das Technologiemanagement umstrukturiert und mir wurde ohne Vorgespräch oder Vorwarnung gekündigt. Ich bin 24 Jahre dort gewesen.
Dann stand ich also da, ohne Struktur. Aber ich bin ja taff, habe an mich die Erwartung, dass ich mein Leben meistere. Ich habe mir gesagt: Das kann jedem passieren, jede Firma muss mal Leute entlassen. Mit Hilfe eines Coaches bin ich jetzt daran, meine Arbeits-Geschichte wieder zu finden. Ich habe auch gemerkt, dass ich sehr auf mich aufpassen muss, habe bewusst den Kontakt zu Freundinnen und Freunden gepflegt, geschaut, dass ich eine Tagesstruktur habe, viel Sport gemacht, habe in der Wohnung handwerklich gearbeitet und einen Bildhauerkurs gemacht.
Ich will wieder eine richtige Arbeit, ich mach das einfach zu gerne. Meinen Gestaltungswillen und meine Energie möchte ich in eine Arbeit mit Sinn investieren. Ich war in den Siebzigern jung. Wir hatten die Ölkrise, Club of Rome etcetera. Nachhaltigkeit war mir immer wichtig. Jetzt haben wir das grosse Thema Klimawandel und Dekarbonisierung. Ich würde gerne etwas zur Verbesserung der Umwelt beitragen. Jetzt habe ich die Chance, konsequent das zu suchen, was ich für richtig halte. Das ist doch eine Supersache, dass ich in meinem Alter meinen beruflichen Schwerpunkt nochmals adjustieren kann. Meine Daseinsberechtigung aber sollte nicht mehr aus dem Job kommen. Die Wurzel und die Quelle sind in mir und nicht in der Firma. Ich empfinde nun viel stärker, dass ich auch etwas wert bin, wenn ich gerade keinen beruflichen Erfolg habe.
Unterdessen kenne ich einige Leute, denen gekündigt wurde. Erst wenn du selbst in der Situation bist, erfährst du, wie viele es davon gibt und erst dann kommen sehr persönliche Gespräche zustande. Die unsägliche Kränkung sitzt den meisten ganz tief. Es ist, als würdest du ausgelöscht werden. Ich wünsche es niemandem, so den Job zu verlieren, aber mich macht’s gefühlt zehn Jahre jünger. Du wirst gezwungen aus der Routine rauszugehen, die Komfortzone zu verlassen und etwas Neues zu packen. Die Arbeit ist ja auch ein Korsett gewesen, ich habe immer wahnsinnig gut funktioniert, auch als die Kinder klein waren voll gearbeitet. Vermeintlich alles im Griff und unter Kontrolle zu haben, ist tatsächlich wie ein Gefängnis. Es war für mich oft nicht mehr unterscheidbar, ob ich selbst etwas wünsche oder die Kinder oder die Vorgesetzten. Es ging nur darum zu funktionieren. Und dann, mit der Kündigung, bricht alles weg. Mit der Zeit merkst du, dass du ausgeglichen sein kannst, ohne alles unter Kontrolle zu haben. Das geniesse ich zurzeit sehr.
An einem Abend ging ich mit meiner Katze im Innenhof spazieren. Ich sah auf einer Bank eine junge Amsel. Wir näherten uns, aber sie flog nicht weg, wie man das erwarten würde. Meine Katze stand ganz nahe bei der Bank, aber lustigerweise schaute sie einfach zum Vogel auf und bewegte sich nicht. Irgendetwas stimmte nicht mit dem Vogel. Ich nahm ihn sorgfältig in die Hand und mit nach Hause. Dort steckte ich ihn ins Katzenkistchen. Die ganze Nacht über hörte ich ihn zwitschern. Am nächsten Morgen machte ich mich sofort auf zur Voliere, um nach Rat zu fragen. Ich war so besorgt, dass der Vogel sterben könnte, dass ich ein Taxi nahm. Der Experte fand das Problem rasch. Der Vogel hatte sich in einem Plastikteil verheddert und konnte deshalb einen Flügel nicht mehr öffnen. Er entfernte das Plastikteil und bat mich, den Vogel am gleichen Ort wieder auszusetzen. Die Eltern des Vogels würden dort auf ihn warten, meinte er, weil junge Amseln noch nicht fliegen können. Auf dem Rückweg nahm ich das Tram, denn jetzt war ich entspannt. Der Vogel sass zutraulich vorne im Katzenkistchen und schaute heraus. Er zwitscherte im Tram und alle Leute drehten sich um, weil sie wissen wollten, was denn da im Katzenkistchen zwischerte. Ich brachte ihn zur Bank im Innenhof und tatsächlich erschienen nach einer Weile die Amseleltern und holten ihn ab. Einige Tage später sah ich auf der Terrasse ein paar Amseln. Ich stellte mir vor, dass mein Vogel wahrscheinlich unter ihnen war. So funktioniert halt unser menschliches Hirn.
Am Anfang war für mich die Frage: Was will ich mit meinem Leben machen? Innerhalb des Rahmens, den wir heute in der Schweiz haben, wie kann ich das meiste daraus machen, am meisten etwas bewirken, das positiv ist, das mein Leben erfüllt? Ich kam zum Schluss: Dort, wo ich aufgewachsen bin, kann ich am meisten bewirken. Ich kenne die Leute, die Geographie, die Lehrer, die Beamten, alles. Dort bin ich am besten vernetzt, das Klima passt mir, ich bin dort in die Schule, meine Kollegen sind dort. So fand ich, ich mache dort mein Lebensprojekt. Vielleicht gehe ich mal für einen Monat oder ein Jahr woanders hin, um Erfahrungen zu sammeln oder eine Ausbildung zu machen. Aber längerfristig möchte ich ins Jura zurück, weil ich dort am meisten bewirken kann.
Mein Zuhause ist eine Gemeinschaft auf einem Bauernhof, zehn Erwachsene plus zwei Kinder, im Sommer kommen noch zwei Erwachsene und zwei Kinder dazu. Das Bauernhaus wurde zu diesem Zweck 1987 gekauft und ich bin dort aufgewachsen. Die Leute bleiben zwei Wochen, zwei Monate, zwei Jahre oder zwanzig Jahre … Manche arbeiten viel auf dem Hof, andere machen Politik oder sind aktiv im Verein. Aber alle haben gewisse Tätigkeiten auf dem Hof, mit den Bienenstöcken, beim Ackerbau, Holzfällen, Kochen, Putzen …
Ich wusste immer, ich möchte in einer Gemeinschaft leben. Ich überlegte mir, was für eine Gemeinschaft möchte ich bilden, wie soll sie aussehen, was kann ich persönlich einbringen? Ich bin nun im letzten Jahr meines Medizinstudiums in Zürich. Als Arzt kann ich einer Gemeinschaft nützlich sein. Auch viele meiner Freunde haben sich diese Überlegungen gemacht; sie lernen nun Dinge wie Architektur, Maschinenbau, Naturmanagement, Umweltwissenschaft, Winzer, Landwirt, Schreiner, Koch.
Die Talgemeinschaft ist mein Lebensprojekt. Gemeinschaft drückt sich über ganz verschiedene Dinge aus, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu essen, sich gemeinsam zu organisieren … Wir haben Ideen wie gemeinschaftliche Nutzung des Bodens, Zusammenarbeit und horizontale Strukturen. Und wir machen ganz konkrete Dinge wie einen Obstgarten anpflanzen. Medizin, Nahrung, Wasser, Energie: Mit diesen Dingen wollen wir uns in unserem Tal selbst versorgen können. Wissen, zum Beispiel über Pflanzen, Böden, Psychologie oder Pädagogik, dafür braucht es vielleicht eine eigene Schule, einen Ort, wo man lernen kann. Mensch kann ja auch eine Weile aus dem Tal weggehen, etwas lernen und wieder zurückkommen, so wie ich jetzt mit dem Medizinstudium. Die Talgemeinschaft stelle ich mir offen vor, so wie die Zelle eines Körpers.
Wir sprechen viel mit den Leuten aus dem Dorf, was sie spannend finden, wie fest sie sich im Projekt engagieren wollen. Es ist wichtig, Grenzen zu respektieren. Es gibt ja auch Leute, die haben keine Lust, mit anderen Leuten im gleichen Haus zu leben. Das ist ganz normal, manche Leute brauchen eben mehr Ruhe und Platz, haben andere Bedürfnisse. Es kann nicht für alle das Gleiche sein. Deshalb kann es innerhalb der Talgemeinschaft auch verschiedene Arten von Gemeinschaften geben und auch Leute, die lieber alleine wohnen, können sich beteiligen, wenn sie möchten. Das Projekt ist etwas Lebendiges und entwickelt sich immer weiter.
Unabhängig vom Projekt der Talgemeinschaft gibt es auch heute schon viele gute Dinge im Dorf. Zum Beispiel die Sägerei, die wichtige Bauteile liefert, oder Vereine, die sich für das Leben des Dorfes engagieren: Musikfestivals, Spielabende, historische Dorfführungen … Das sind alles Projekte, die ebenfalls zum Ziel haben, dass sich wieder eine stärkere Dorfgemeinschaft bildet.
Die Leute reagieren sehr positiv auf das Projekt, es ist sehr viel positive Energie vorhanden. Es kommen viele Leute aus Interesse von ausserhalb vorbei, auch gute Freunde aus Zürich. Auch die Leute aus dem Dorf und aus der Umgebung finden es mega cool und möchten wissen, was die Gedanken dahinter sind. Das ist ja auch ihr Lebensraum und daran ist man grundsätzlich interessiert. Im Dorf leben ganz unterschiedliche Leute und dadurch ergibt sich automatisch eine grosse Vielfalt im Austausch. Gerade dieser vielfältige Austausch mit verschiedenen Leuten macht das Projekt so positiv und auch anders als Projekte mit Leuten, die sich sehr ähnlich sind. Ich habe natürlich eine eigene Vorstellung, wie sich das Projekt entwickeln könnte. Aber schlussendlich muss es einfach für die Leute, die dort leben, stimmen. Ich habe keinen Willen, etwas aufzuzwingen. Zwang kann nicht positiv sein. Ich kann Impulse geben, Themenabende organisieren. Der Prozess ist viel wichtiger als das Zielbild, das ändert sich ja ständig. Es geht darum, das Leben und die Vielfalt zu verbessern.
Was macht mich glücklich? Das Leben, gut essen, mich mit Freunden treffen, mein Medizinstudium, Velo fahren, Fantasy-Bücher lesen, Sonne, Regen; viele Leute, das Leben und seine Entwicklung. Ich möchte das auch so. Wenn ich traurig sein wollte, könnte ich das sicher auch, könnte denken, die Welt ist schlecht und ich kann nichts machen. Aber ich habe keine Lust, mein Leben zu verderben. Weil ich mich entschieden habe weiterzuleben, mache ich etwas möglichst Schönes draus.
Ich bin mir schon bewusst, dass ich in einer privilegierten Situation bin. Ich kann frei wählen, was ich studiere, wo ich wohne, mit wem ich mich treffe, ich habe Zugang zu allem. Als Schweizer Student kann mensch alles haben, ein Visum, ins Ausland fliegen … Wenn du Lust und Energie hast, geht alles. Diese Chance hat nicht jeder, nicht in der Schweiz, nicht in Europa, nicht auf der Welt. Ich bin auch privilegiert, weil ich in einer Familie mit guten Beziehungen bin.
Die Zukunft macht mir keine Angst. Sie kommt, ob ich will oder nicht. Ich möchte auch nicht zu fest über die Zukunft nachdenken, mensch lebt ja nur einmal. Man sollte jeden Augenblick geniessen, vielleicht sind wir morgen alle tot oder auch nicht. Die Gemeinschaft bietet mir die Möglichkeit und Sicherheit, zurückkehren zu können, wenn etwas nicht funktioniert. So habe ich viel grössere Freiheit und weniger Druck. Mit Angst zu leben habe ich keine Lust, ich sehe, wie einschränkend das ist. Ich bin überzeugt: Mensch hat immer die Wahl. Die Kunst ist, die Augen offen zu halten.
Als mein Mann in einem Quartierladen in Wollishofen arbeitete, brachte ich ab und zu Kuchen vorbei. Die Kunden haben die Kuchen immer schnell weggegessen. Es gab Kundinnen, die himmelten einen regelrecht an. Wenn die alle so gerne haben, dann muss ich halt regelmässig Kuchen für den Verkauf backen, fand ich irgendwann. Ein bis zwei Jahre habe ich dann Kuchen gebacken, meist in der Nacht, ich hatte ja nur dann Zeit. Die ganze Wohnung hat nach Kuchen gerochen. Eines schönen Morgens kommt dann der Lebensmittelkontrolleur in den Laden und fragt: Woher kommen diese Kuchen? Zuhause backen dürfen Sie nicht! Das war meine Rettung. Ich war so froh, dass ich nicht mehr backen musste. Jetzt zeichne ich Kuchen und andere Dinge. Das ist gesünder, kein Cholesterin, und erst noch viel billiger.
Letztes Jahr habe ich zum ersten Mal beim Plastikfasten mitgemacht. Eine Woche lang versucht man, ohne Plastik auszukommen. Die Aktion beginnt gerade zum zweiten Mal. Schon beim ersten Mal habe ich konsequent kein Plastik gekauft. Da ich ausschliesslich Bio-Lebensmittel kaufe, die aber meistens noch mehr verpackt sind, fiel mir das so richtig schwer. Ich musste einige Kompromisse eingehen, mich entscheiden, bio oder plastikfrei. Es gibt ein Plastikfasten-Tagebuch online, wo man über seine Erfahrung schreiben kann. Letztes Jahr habe ich das nicht gemacht, ich war genug gefordert mit der Aufgabe an sich. Dieses Jahr habe ich es mir aber fest vorgenommen, meine Erfahrungen zu teilen. Schon im Vorfeld war ich aktiv und habe versucht, viele Menschen in der Schweiz und im Vorarlberg zum Mitmachen zu motivieren.
Das Schlüsselerlebnis letztes Jahr war: Ich habe mich eine Woche lang darauf eingelassen und es lässt mich nicht mehr los, das ist phänomenal. Dieses Jahr plane ich keine Kompromisse mehr zu machen und werde konsequent nur unverpackte Bio-Produkte einkaufen. Wo das nicht möglich ist, möchte ich das Verpackungsmaterial im Geschäft zurücklassen. Am allerliebsten gehe ich direkt zu den Bauern, wo das Bio-Gemüse unverpackt in die mitgebrachte Einkaufstasche gelangt.
An diesem Freitag hiess es dann: Schulen zu. Ich hätte nie damit gerechnet, war felsenfest davon überzeugt, dass sie das nicht machen. Ich habe meine schöne Agenda angeschaut, in die ich mit Bleistift schreibe, und erstmal fast alles ausradiert. Nach 16 Jahren als Primarlehrerin war ich in einer Art Sabbatical und wollte bis im nächsten Sommer mit Lehrvertretungen und Kursen an der Pädagogischen Hochschule mein Geld verdienen. Jetzt wusste ich: that’s not gonna happen.
Vor vier Jahren habe ich meine Ausbildung als Beraterin für Lehrpersonen und Eltern abgeschlossen. Mir war sofort klar, dass jetzt ganz viele Familien in einer schwierigen Situation sind. Struktur, klare Abläufe, Regeln und Abmachungen sind so wichtig zum Lernen. Und wenn die Kinder plötzlich zu Hause lernen, fällt das alles erstmal weg. Da spürte ich plötzlich wahnsinnig viel Energie. Eigentlich bin ich ja Expertin für dieses Thema! Genau das mache ich unglaublich gerne und weiss unglaublich viel. Das ist es, in dem bin ich gut! Ich kann die Familien zuhause unterstützen, zeigen, wie man es machen könnte. Homeschooling Zürich, so muss das Projekt heissen und auf Facebook ist die Seite noch frei. In einem Marathon, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag habe ich durchgearbeitet, die Seite aufgebaut, Angebote entwickelt. Selbstständig arbeiten wollte ich eigentlich schon eine Weile lang, aber mit einem 100%-Job hatte ich nie die Zeit gefunden, etwas aufzubauen.
Als Lehrerin habe ich immer gerne mit Rollenspiel gearbeitet, ein Stoffschaf genommen und das Schaf sagt: «das ist aber ein Saumeis hier». Die Kinder finden das lustig, nehmen auf das Schaf Rücksicht. Selbst die coolsten Buben wollten das Schäfchen oder Häschen an ihren Platz nehmen. Dieses Rollenspiel mit Tieren kam mir jetzt wieder in den Sinn, als ich mir überlegte, wie ich in dieser Situation jetzt am besten helfen kann. Ich kam auf die Idee, eine Miniklasse aus Stofftieren zu erfinden, und mithilfe dieser Stofftierklasse Geschichten zu erzählen, die beim Lernen zuhause helfen. Jedes Tier hat einen Namen und einen Charakter. Beno Büffel zum Beispiel büffelt gerne und ärgert sich, wenn er sich nicht konzentrieren kann. Musik hilft ihm, sich auf eine Aufgabe einzulassen. Es macht mir extrem Spass, solche Geschichten zu spinnen. So können Eltern und Kinder auf schöne Art und Weise lernen, wie Lernen zuhause besser gelingen kann.
Wichtig ist für mich, dass es den Computer ja nicht immer braucht. Wenn eine Familie drei Kinder hat und die Eltern Homeoffice machen, hat man ja nicht einfach fünf Computer zu Verfügung. Es gibt auch Familien, die gar keinen Computer haben und die jetzt besondere Unterstützung brauchen. Man ist jetzt so darauf fokussiert, dass alles digital ablaufen muss, dass man vergisst, dass uns die Umwelt ganz viele Lernmöglichkeiten gibt. Ich schlage Dinge vor, die man zuhause machen kann, auf dem Balkon, im Wald.
Die Miniklasse-Geschichten sind auf meiner Seite für alle zugänglich. Natürlich hoffe ich, dass sich auch jemand für eine persönliche Beratung meldet, ich muss ja in Zukunft auch etwas verdienen. Es gibt zwar eine Fülle an Information, Tipps und Apps für Eltern, was man mit den Kindern machen könnte. Trotzdem habe ich das Gefühl, es braucht das persönliche Gespräch. Jede Familie ist individuell, es hängt davon ab, wie die Kinder sich verhalten, was sie für einen Charakter haben, wie die Eltern leben. Manchmal ist man überwältigt von den tausend Tipps, es muss doch funktionieren, denkt man, und das tut es dann nicht. Ich konnte schon eine Beratung mit einer Familie durchführen, wir konnten ganz viel sortieren, Struktur geben, Abmachungen treffen.
Es finden jetzt ja viele Diskussionen statt, was die Auswirkungen dieser Situation sind. Ich finde, man unterschätzt die Kinder und unser Schulsystem. Es passiert jetzt auch wahnsinnig viel, bei ganz vielen Menschen ist ganz viel Energie freigesetzt worden. Ich bin sehr überzeugt, auch wenn man vier Monate gar keinen Unterricht hätte, dass man das gut aufholen könnte. Es braucht jetzt Rücksicht und Gelassenheit für Eltern und Kinder, dass nicht alles von Anfang an funktionieren muss. Und Zuversicht, Geborgenheit, Sicherheit, dass es im Fall schon gut kommt.
Wir haben in unserem Garten unter der Pergola einen Ping-Pong-Tisch, den man von der Strasse aus sehen kann. Vorhin lungerten zwei junge Leute in unserer Einfahrt herum. Ich ging raus.
Sie fragten, ob das ein öffentlicher Tisch sei. Sie müssten sich dringend wieder einmal an der frischen Luft austoben nach den Tagen im Homeoffice.
Nein, das ist privat, sagte ich, aber von mir aus könnten sie ihn gerne benutzen. Ich würde ihnen gleich die Schläger und Bälle rausgeben.
Nicht nötig, sie hätten alles dabei und suchten einfach im Quartier einen Tisch.
Ich sagte, dass es beim Schulhaus nebenan auch einen Tisch habe.
Sie meinten, sie würden gleich schauen gehen, ob er frei sei. Ansonsten kämen sie gerne auf mein Angebot zurück.
Schade, der Tisch auf dem Pausenplatz war offensichtlich frei, darum ist unser Tisch auf dem Bild unbenutzt.
Eine meiner langjährigen Kundinnen war heute da zum Haare-Schneiden und erzählte mir von stories for future. Da ist mir spontan auch eine Geschichte in den Sinn gekommen:
Im Eingang meines Hauses steht seit über einem Jahrzehnt dieses alte Schränklein. Es ist hölzern und weiss und hat viele Schubladen. Ich wollte seit langem gerne etwas Neues an dieser Stelle. Je mehr Schubladen du hast, desto mehr Krempel sammelt sich an. Also stellte ich mir etwas ganz Schlichtes vor: Ein Brett oben und zwei an den Seiten, also so ein umgekehrtes U, basta. Aber ich fand nie etwas, das mir gepasst hätte und machen lassen ist krass teuer, obwohl es so einfach ist, so 700 Franken mindestens. Da hatte ich die Nase voll und beschloss, aus dem alten Schränklein halt etwas Neues zu machen.
An einem anderen Ort in der Wohnung habe ich ein gelbes Möbel, das mir sehr gefällt. So sollte das Schränklein im Gang auch werden. Zum Glück haben wir im Dorf noch einen Maler, der sein Handwerk beherrscht. Ich gab ihm ein Foto der gelben Farbe. Er verschwand im Keller und kam nach einer Weile mit einem Muster zurück, das voll passte. Ich habe dann das alte Schränklein neu angemalt und es ist so gekommen, wie ich gehofft hatte: Es ist ein völlig neuer, frischer Anblick, wenn man ins Haus kommt. Wegen dem Krempel in den Schubladen muss ich mich halt mehr zusammennehmen.
Vor zwei Jahren bekam ich mein erstes Rollbrett geschenkt. Mein ganzes Leben lang fand ich das Pendeln und Vorwärtskommen in Zürich mühsam. Die Staus, das Rennen auf den Bus, der Kampf um Sitzplätze und weshalb kommt mein Tram immer zuletzt. Als ich dann das erste Mal meinen Arbeitsweg mit dem Rollbrett zurücklegte, hat es klick gemacht. Seither bin ich in Zürich meist so unterwegs. Was früher verlorene Zeit zwischen A und B war, ist nun ein tägliches Vergnügen. Das Fahren macht Spass und die Stadt um mich herum erlebe ich intensiver. Die Menschen reagieren manchmal, wenn ich an ihnen vorbeikurve, meistens positiv, selten nervt’s jemand ein bisschen. Meine Fortbewegung in der Stadt ist viel freier geworden. Letztes Tram weg, Demonstration an der Bahnhofstrasse, Fahrleitungsstörung am Hegibachplatz, Unfall am Bellevue, alles kein Problem. Bei schönem Wetter mache ich manchmal extra einen Umweg. In kurzer Zeit habe ich so mehr von der Stadt kennengelernt als in vielen Jahren zuvor. Ich hätte nicht gedacht, dass Zürich so viele spannende Orte zu bieten hat. Muss es schnell gehen oder regnet es, klemme ich mir das Brett unter den Arm und nehme den Bus. Ich habe Glück, dass ich mir in meiner Arbeit immer mal wieder die Zeit nehmen kann, etwas länger unterwegs zu verweilen. Und Glück, dass es in Zürich so viele schön glatte Trottoirs gibt.
Wir hatten schon immer Nachfrage nach einem Second-Hand-Bereich in unserem Laden. Mit unserem Tauschsystem haben wir das jetzt noch viel besser umgesetzt, elegant und intuitiv, spielerisch. Man stellt seine Freitag-Tasche online und wählt aus, an welchen Taschen anderer Kunden man interessiert wäre. Ergibt sich ein Match, dann organisiert man zusammen den Tausch.
Das ist super für Leute, die etwas nicht mehr wollen. Man kann sich viel besser trennen. Nicht nur muss man nichts mehr wegwerfen, sondern man bekommt sogar etwas Neues dafür. Vielleicht sogar etwas, von dem man gar nicht gewusst hat, dass man es wollen könnte. Wir haben auch im Laden Second-Hand-Taschen, die man nur tauschen kann. Leute, die das erste Mal in den Laden kommen, die verstehen es manchmal nicht. Weshalb kann man diese Tasche jetzt gar nicht kaufen? Diejenigen, die zum Tauschen kommen, finden es mega cool, sagen, so geil, dass ihr das macht. Wir merken, der Bedarf nach unseren Produkten ist da, ob neu oder gebraucht, spielt gar nicht so eine Rolle.
Schadet das Tauschen unserem Geschäft? Nein, im Gegenteil. Es führt ja dazu, dass sich die Menschen noch mehr mit unseren Produkten anfreunden. Wenn die Leute happy sind, dient uns das auch. Ich finde, es ist auch für unsere Firma gesund, zu sagen, dass es nicht nur Konsumieren gibt. Am letzten Black Friday haben wir den ganzen Online-Store offline genommen und dafür die Tauschbörse auf die Startseite geschaltet. Das vermittelt für mich genau das Richtige.
Es ist ein mutiger Schritt, aber irgendwie hat sich gezeigt, dass alle mutigen Schritte positiv waren. Es ist cool, dass wir uns nicht zu schade sind, dass wir das aus einer grösseren Perspektive sehen können. Dass wir es nicht nicht machen, nur weil es uns potentiell schaden könnte. Und ja, das ist ein mega Luxus. Ich denke das so oft. In sieben Jahren bin ich noch nie ungern zur Arbeit gekommen.
Das Thema Asyl und Flüchtlingsbetreuung begleitet mich mein ganzes Leben. Als ich für den Grossrat kandidierte, bekam ich ein Telefon von einem Mann, der von mir wissen wollte, wie ich zu den vielen Asylbewerbern stehe. Je nachdem bekäme ich seine Stimme. Es folgte ein Sermon von: Die nützen uns doch nur aus, seien keine echten, sondern die meisten nur Wirtschaftsflüchtlinge, viel zu viele etcetera. Ich sagte ihm, dann dürfe er mich nicht wählen, ich sei da absolut nicht seiner Ansicht und ich erzählte ihm von den kurdischen Männern, die ich damals betreute. Na ja, eine Stimme weniger dachte ich, als das Gespräch beendet war. Etwa zwei Stunden später läutete es und an der Tür stand dieser Mann mit zwei grossen Säcken Frotteewäsche und Kleidern. «Für diese Kurden», brummte er und ging wieder. Keine Ahnung, ob er mich schlussendlich gewählt hat.
Die Tradition kommt von der Mutter einer guten Freundin. Zweimal pro Jahr gab es in der Bauernfamilie Fasnachtschüechli: zur Fasnacht und zum Geburtstag des Vaters. Omama Schüfeli hatte eine neue Methode entdeckt: Anstatt den Teig langzuziehen, faltete sie ihn mehrmals und glättete ihn mit dem Wallholz. So wurden sie hauchdünn und zart. Pro Tag durfte man ein Fasnachtschüechli essen, der Vater zwei.
Als meine Freundin mit der Tradition aufhörte, machte ich bei mir zuhause weiter. Manchmal helfen mir Leute, das ist einfach lustiger. Den Grossteil der Fasnachtschüechli verschenken wir und natürlich bekommt meine Freundin jedes Jahr ebenfalls eine Portion, auf die sie sich immer sehr freut.
Den Tag für das Zubereiten trage ich mir immer in die Agenda ein. Die Utensilien dieses eine Mal im Jahr aus dem Schrank zu holen, die Schindeln, die Bürste, die Gefässe, bereits das ist etwas Schönes. Und das Zubereiten ist jedes Mal wieder etwas Besonderes. Zuerst dieses «Wilde», wenn man den Teig auf den Tisch hinabschmettert. Dann das «Difficile», wenn man den Teig nach Omama Schüfelis Methode faltet und auswallt, nicht zu viel, nicht zu wenig. Anschliessend das Mehl vom Teig abbürsten mit der Bürste, die ich noch von meiner Freundin habe. Die Chüechli fühlen sich schön kühl und fein an auf den Händen. Am Schluss wird es ein bisschen aufregend, wenn man die Chüechli in der heissen Butter kocht, nur wenige Sekunden, sonst werden sie zu dunkel. Mit Schindeln, die ich noch von meiner Grossmutter habe, fischt man sie dann raus. Etwas Zucker darauf streuen, in Stapeln von sechs auf verschiedene Teller legen, dann sind sie fertig.
Das Rezept ist immer noch das Gleiche wie das von Omama Schüfeli. Was ich sehr schön finde, ist, dass es so simpel ist: Eier, Rahm, Mehl, Salz. Man braucht Wissen, das heisst das alte gute Rezept und die Methode von Omama Schüfeli, viel Sorgfalt und Zeit und daraus gibt es dann etwas Kostbares, das man nicht kaufen könnte. Ich habe halt eben wirklich gerne gute Sachen. Für die Läden wäre das gar nicht möglich, die machen Fastnachtschüechli viel dicker, sonst würden sie ja gleich zerbrechen.
Weil sie so zerbrechlich sind, ist das Ausliefern immer eine besondere Herausforderung. Vor vielleicht dreissig Jahren haben wir gemerkt: mit den Plastikbehältern für Fasnachtschüechli aus der Migros geht das ganz gut. Seit da liefern wir sie mit ein und denselben Behältern aus; ich bekomme diese dann im Verlauf des Jahres wieder zurück, zum Beispiel, wenn ich meine Weihnachtsguetzli ausliefere. Einmal traf ich meine Freundin in einem berühmten Restaurant, um ihr die Fasnachtschüechli vorbeizubringen. Der Koch kam am Tisch vorbei. Wir haben ihm ein Chüechli zum Probieren gegeben und er hat gesagt: «die sind aber sauguet». Das hat mich natürlich gefreut.
Ich empfinde bei all dem eine starke Kontinuität. Ich lese keine Rezepte, niemand sonst empfiehlt mir etwas, es ist dieser einzigartige Faden, der ohne Einfluss von aussen weitergesponnen wird. Das gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit, von Ordnung in einem ganz weiten Sinn. Selbst wenn ich es allein mache, habe ich immer noch das Gefühl, in einem Zusammenhang zu stehen: zu einer Tradition und den Menschen, die damit verbunden sind. Wenn meine Freundin, die jetzt ja schon älter ist, einmal nicht mehr da ist, dann mache ich trotzdem weiter. Aber nicht nur für mich selbst, es gehört schon dazu, dass es jemand gerne hat. Ich habe eigentlich gedacht, dass diese Tradition mit mir endet. Aber vielleicht stimmt das ja nicht.
Unser alter Turmix-Handmixer konnte eines Tages nur noch im Rückwärtsgang betrieben werden. Der Schalter liess sich einfach nicht mehr nach rechts zu den fünf Stufen im Vorwärtsgang bewegen. Mein Mann wollte ihn entsorgen, weil es sich ja sicher nicht mehr lohne, das gegen zwanzig Jahre alte Stück reparieren zu lassen. Es war klar, dass der Motor in Ordnung war. Vielleicht lag es ja nur an einem verklemmten Schalter. Ich versprach, einen Flick-Versuch in einem Repair-Café zu unternehmen. In den Wochen bis dahin haben wir halt einfach im Rückwärtsgang gemixt.
Für den Besuch im Repair-Café habe ich mir extra etwas zum Lesen mitgenommen, aber ich konnte meinen «Patienten» sofort registrieren lassen. Ein älterer Herr nahm mich mit in den ersten Stock, wo auf einem Tisch fein säuberlich Werkzeuge ausgelegt waren. Zum Glück sei es ein altes Markenprodukt, so der pensionierte Ingenieur. Heute werde bei den chinesischen Billigprodukten mehr und mehr verleimt oder verschweisst, reparieren sei gar nicht vorgesehen. Er drehte und wendete den Mixer, um eine Öffnung zu finden. Es war ein rechtes Geduldspiel.
Lag mein Mixer erst einmal offen auf dem Tisch, wurde der Fehler schnell gefunden und behoben. Noch ein Tropfen Öl, zusammensetzen und ein kurzer Test – alles perfekt. Ich bedankte mich herzlich, legte ein Zehnernötli in die Spendenkasse und fuhr glücklich mit meinem neuen-alten Mixer nach Hause. Auch mein Mann hat sich gefreut.
Unsere Familie ist gross, drei Töchter, ich und mein Mann. Mittlerweile sind alle im Alter, wo sie ihr eigenes Leben haben, einen eigenen Fahrplan und unterschiedliche Bedürfnisse. Irgendwann wurde es schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Zusammen Mittagessen oder Znachtessen wie zu Primarschulzeiten ging plötzlich nicht mehr. Die eine Tochter geht ins Basketballtraining, die andere kommt aus dem Stall zurück und so weiter. Das unterschiedliche Timing hat sehr viel Unfrieden gebracht. Ich musste mich fragen, wie koche ich, dass das Essen nicht kalt wird, muss ich in zwei Etappen kochen …? Und dann die eine Tochter: «Ihr kochst du immer, mir nicht …». Oder sie assen Brötchen auf dem Heimweg, was dann die Mutter hässig macht, die gekocht hat … Die Dynamik ist einfach anders, wenn der Alltag nicht mehr synchron ist.
Irgendwie hat uns das gestunken und wir haben gesagt: Wir brauchen einen neuen Plan. Immer am Sonntagabend nach dem Znacht findet bei uns eine Familienkonferenz statt. An einer Familienkonferenz haben wir dann besprochen: Wie wollen wir kochen? Was ist uns wichtig, wer muss wann gegessen haben, wie macht man das? Die Lösung sieht folgendermassen aus: Am Montag essen wir Resten vom Sonntag. Am Dienstag geht die erste Tochter in den Stall, die zweite ins Klettern und die dritte ins Basketball und ich arbeite bis spät, also schaut jeder für sich selbst. Am Mittwoch koche ich, weil ich immer zuhause bin. Donnerstag ist wie Dienstag, Selbstbedienung. Am Freitag kocht jemand, aber wir lassen offen wer, und Samstag um 12 Uhr essen wir zusammen Zmittag.
Die älteste Tochter isst am liebsten Spaghetti füdliblutt, die mittlere vegetarisch oder vegan, die jüngste währschaft. Mein Mann mag Fleisch. Ich bin Allesfresser. Früher war es immer ein Ghetto, jeder hat rumgemüffelt. Nun hat es viel Entlastung und Entspannung gegeben. Ich habe Freude, neue Sachen zu entdecken, etwas auszuprobieren, zum Beispiel Linsen. Wir essen weniger Fleisch, aber auch mein Mann findet’s gut. Wenn Selbstbedienung ist, kann er sein Fleisch machen und wir Linseneintopf. Wir konnten Verantwortung an die einzelnen Familienmitglieder übergeben. Auch meine jüngste Tochter hat gelernt zu kochen. Wir haben jetzt auch weniger Resten als früher. Da hab ich häufig zu viel gekocht, für fünf und nur zwei sind gekommen oder sie hatten keinen Hunger. Das Budget hat auch profitiert. Wir geben gleich viel aus, aber kaufen dafür viel mehr Bio und aus der Region.
Die Essensgeschichte ist auf gutem Weg. Sie hat uns zufriedener gemacht, es wird abwechslungsreicher gekocht, die Eltern sind entlastet und die Kinder und jungen Erwachsenen werden selbständiger. Mit dem Älterwerden unserer Töchter hat sich unser Zusammenleben von einer Familie hin zu einem WG-ähnlichen Zusammenleben entwickelt. Wie wir offiziell abgemacht haben, wollen wir daran festhalten, ab und zu zusammen zu essen. Es ist ein sehr guter Kompromiss. Man muss jetzt nicht mehr dem Familienleben nachtrauern, weil man weiss, es kommt ja bald wieder ein Abend, an dem wir zusammen essen.
Das Erzählen dieser Geschichte ist übrigens mega lässig. Ich merke jetzt, wenn ich darüber nachdenke: Ich bin saustolz auf unsere Familie. Es macht mich stolz zu sehen, wie veränderungsbereit wir sind. Es ist eine gute Geschichte, zu sehen, wie die Kinder und wir an Kompetenzen gewinnen, wie wir argumentieren, reflektieren und uns fragen: Wie wollen wir es gerne haben?
Am ersten Geburtstag meiner Tochter wurde im Züri-Zoo ein Elefantenbaby geboren. Meine Tochter ist nun ein grosser Fan von Elefanten. Eines ihrer ersten Wörter war das Wort «Bebefant». Das hat mich zum gleichnamigen Projekt inspiriert.
Bebefanten sind Spielzeugelefanten mit Rädern. Sie sind aus verschiedenen Kartonteilen zusammengesteckt. Man kann sie auseinandernehmen und wieder zusammenstecken. So muss nichts geleimt werden, das ist auch ökologischer. Ich wollte herausfinden, wie weit man mit diesem Prinzip gehen kann. Ich war immer schon an haptischen Materialien und dem Umsetzen von 3-Dimensionalem interessiert. Besonders Karton fasziniert mich, ein nachhaltiges und vielfältiges Material. Mich reizt, herauszufinden, wie robust Karton ist und was man damit alles machen kann. Wenn er kaputt ist, kann man ihn rausstellen zum Recyclen.
Zuerst waren die Bebefanten klein, mittlerweile haben sie die Grösse eines Laufrades. Nach dem fünften Prototypen habe ich jetzt die finale Version des Bebefanten mit einer limitierten Auflage von 50 Exemplaren. Meine Tochter hat die ganze Entwicklung mitbekommen. Es hat mich angespornt, als ich gemerkt habe, dass sie Freude daran hat. Als sie einmal am Rüssel gezogen hat, bin ich auf die Idee gekommen, dem Bebefanten etwas Mobiles zu geben. Nun kann der Bebefant mit dem Rüssel kicken, zum Beispiel einen Fussball.
Vor dem Bebefanten-Projekt hatte ich 7 Jahre lang ein Atelier an der Langstrasse und arbeitete dort als Grafiker und Illustrator. Nach einem Time-out erhielt ich dann im leerstehenden Altersheim Hottingen für ein Jahr ein kleines Zimmer zur Zwischennutzung. Ich wollte herausfinden, wie es für mich ist, in einem ganz eigenen Raum an eigenen Projekten zu arbeiten. Ich habe mir gesagt: Dieses Jahr widme ich hauptsächlich dem Bebefanten, um für mich zu entdecken, wie es ist, ein Produkt von A bis Z zu entwickeln. Diese Zeit des Ausprobierens konnte ich mir erlauben, da ich kurz vor meinem Time-out ein Erbe bekam. Ich habe mir damit ein bisschen Unabhängigkeit in der Arbeit und Spontanität im Tagesablauf geschenkt. Ich sagte mir: Nun mache ich, was ich gern möchte. In der Sprache meiner Tochter heisst dies: Ich will, was ich mache.
Mit dem Beginn im neuen Atelier werde ich mich wieder mehr um kommerzielle Arbeiten kümmern müssen. Eventuell werde ich auch eine Teilzeitarbeit als Grafiker suchen, denn ich habe gemerkt: Diese Zeit mit der ganz freien Arbeit an eigenen Projekten möchte ich eigentlich nicht mehr missen.
Ich bin ganz glücklich, dass es in der Nähe unserer Wohnung Bücherkisten gibt, zum Beispiel am Bahnhof Wipkingen und beim Letten. Bei den Bücherkisten kann man Bücher bringen und nehmen. Jedes Buch wird so mehrmals gelesen, das finde ich schön. In Bücher-Brockis bin ich überfordert, da gibt es viel zu viele Bücher. In den Bücherkisten hat es nur wenige Bücher, da hat man einen guten Überblick. Und man kann auf alles stossen, von Babyratgebern über hohe Literatur bis zum Kinderbuch. In den Bücherkisten würde ich nicht gezielt nach etwas suchen, aber wenn ich zufällig daran vorbeilaufe, dann schaue ich nach und finde vielleicht etwas, manchmal auch etwas, was ich sonst nicht lesen würde.
In Amden an der Post, wo wir viel in den Ferien sind, da musste die Post leider schliessen, weil gespart werden muss. Der Vorraum hinter der Eingangstüre der ehemaligen Post steht nun leer. Dort möchte ich gerne etwas mit Büchern initiieren, zum Beispiel ein Büchergestell, wo die Leute Bücher bringen oder nehmen können. Oder auch nur lesen, zum Beispiel die Leute, die gleich nebenan auf den Bus warten müssen. Eine Bäuerin, die von der Idee gehört hat, hat gesagt: «So gut, dann finde ich vielleicht einmal ein Buch über’s Spinnen.»
Also, was ist für mich Lebensqualität? Gehen. Jeden Tag gehe ich dieselbe Strecke von mir daheim hinauf zum Dolder. Wenn man immer den gleichen Weg geht, schenkt man den Dingen viel mehr Aufmerksamkeit und man beginnt, Details zu sehen. Ich kenne all die Bäume auf dem Weg, nicht botanisch, aber wie sie aussehen. Jeden Tag ist eine andere Stimmung. Die kleinsten Veränderungen fallen einem auf, zum Beispiel haben sie jetzt auf dem Golfplatz neben dem Weg ein Nicht-betreten-Schild aufgestellt. Im Winter war das anders, da ist dort oben ein grosser Schlittelplausch. Nach dem Hirnschlag vor ein paar Monaten musste ich alles wieder neu lernen, lernen zu sprechen, lernen zu gehen. Medizinische Trainingstherapie in den Krafträumen ist so stier, damit habe ich schnell aufgehört. Dafür habe ich beschlossen, jeden Tag eine Stunde draussen zu spazieren. Das ist viel schöner, spannender, man kommt in die Natur. Was als Training angefangen hat, ist zu einem Vergnügen geworden. Meine Partnerin hat jetzt auch Freude daran bekommen und an vielen Tagen spazieren wir zu zweit.
Ich gehe immer zum gleichen Coiffeur und beim Haareschneiden hat er mir diese Geschichte erzählt. Wie fast alle Geschäfte heute hatte er ein Bezahlterminal, mit dem man kontaktlos mit der Karte bezahlen konnte. Eines Tages kam von der zuständigen Firma die Aufforderung, er müsse für teures Geld ein neues Gerät kaufen, Grund sei eine neue Software. «Dann macht doch auf meinem alten Gerät ein Software-Update», meinte mein Coiffeur. Darauf wurde ihm mitgeteilt, dass dies nicht gemacht werde. «Das ist ja ein riesiger Unsinn, für ein Software-Update ein teures neues Gerät kaufen zu müssen, und dazu ein ökologischer Wahnsinn», meinte er. Und sagte zur Dame am Telefon: «Mit einer Firma, die so fahrlässig mit unseren Ressourcen umgeht, möchte ich nichts mehr zu tun haben.» «Sie haben doch gar keine Wahl», lautete die Antwort. Wenige Tage später war der Vertrag gekündigt und mein Coiffeur hatte eine schöne alte Kasse aufgetrieben, eine mit Klingelton, wie man sie aus Filmen kennt. Ein alter Bekannter kannte sich noch mit dem Mechanismus aus. Nun bezahlt man nur noch in bar. Hat jemand kein Geld dabei, gibt’s vis-à-vis auf der Strasse einen Bankomat. Gestört hat’s nach seiner Aussage nur einen Kunden. Alle anderen finden die Kasse toll – auf Wunsch dürfen die Kunden sie auch selber bedienen.